
Dies ist keine Liebesgeschichte
Roman
„José A. Pérez Ledo sorgt für Gefühlskino.“ - literaturmarkt.info
Dies ist keine Liebesgeschichte — Inhalt
Daniel Durán glaubt nicht an die Liebe. Der Mittdreißiger ist überzeugt, dass die großen Gefühle nichts weiter sind als ein gefaktes Produkt aus der Traummaschinerie Hollywood. Deshalb fällt er aus allen Wolken, als seine beste Freundin Sara ihn bittet, ihr Trauzeuge zu werden. Doch während der Hochzeitsvorbereitungen lernt der neurotische Daniel die quirlige, verrückte und ziemlich hübsche Kindergärtnerin Eva kennen und mit einem Mal ist er sich seiner Überzeugungen gar nicht mehr so sicher. Hollywood hin oder her – Eva will erobert werden. Und plötzlich erlebt Daniel seine ganz persönliche Liebesgeschichte ...
Leseprobe zu „Dies ist keine Liebesgeschichte“
Kapitel 1
Dies ist keine Liebesgeschichte.
Besser, Sie wissen es von vornherein – nicht, dass Sie mich am Ende noch für Ihren Frust verantwortlich machen. Das Leben birgt schon genug Enttäuschungen, es wäre einfach absurd, sich noch eine weitere aufzubürden – erst recht aus einem so dämlichen Grund. Falls Sie also eine dieser Personen sind, die von zärtlichen Blicken unter Sternenhimmeln träumen, ewiger Treue etc., sind Sie hier falsch. Was soll ich sagen – sorry.
Wenn Sie mich fragen – und glauben Sie mir, ich habe die Sache wirklich ziemlich gut [...]
Kapitel 1
Dies ist keine Liebesgeschichte.
Besser, Sie wissen es von vornherein – nicht, dass Sie mich am Ende noch für Ihren Frust verantwortlich machen. Das Leben birgt schon genug Enttäuschungen, es wäre einfach absurd, sich noch eine weitere aufzubürden – erst recht aus einem so dämlichen Grund. Falls Sie also eine dieser Personen sind, die von zärtlichen Blicken unter Sternenhimmeln träumen, ewiger Treue etc., sind Sie hier falsch. Was soll ich sagen – sorry.
Wenn Sie mich fragen – und glauben Sie mir, ich habe die Sache wirklich ziemlich gut durchdacht –, ist die romantische Liebe die größte kollektive Illusion der Geschichte; ein mehr oder minder geschickt eingefädelter Betrug, dem alle Menschen ohne Ausnahme unfreiwillig aufsitzen. Und ich rede hier nicht vom Pärchendasein. Ich meine das idealisierte Konzept der romantischen Liebe und das ganze Tamtam, das darum veranstaltet wird. Mann lernt Frau kennen (oder umgekehrt), Mann und Frau verlieben sich, streiten, trennen sich, versöhnen sich wieder, Kuss, Musik, Abspann. Man hat das tausendmal gesehen. Jeder von uns ist damit aufgewachsen.
Falls Sie nicht zufällig als Baby im Dschungel ausgesetzt wurden und zwischen Pavianen aufgewachsen sind, dann sind diese Bilder auch Teil Ihrer emotionalen Bildung. Und wissen Sie was? Es gibt nichts, das man tun könnte, um diese Bilder aus seinem Unterbewusstsein zu löschen. Sie sind da, so tief verwurzelt im Hippocampus wie das kleine Einmaleins oder der Name der französischen Hauptstadt.
Die Schuld daran, oder einen Großteil der Schuld, trägt diese Traumfabrik namens Hollywood. Obwohl das nicht immer so war. Ursprünglich beschränkte sich die Filmindustrie auf Geschichten, die so einfach gestrickt waren, dass sie beinahe als schwachsinnig durchgehen konnten: Gärtner, die sich mit ihren eigenen Gartenschläuchen nass spritzten, Arbeiter, die von ihren Baugerüsten stürzten … Doch dann kam der Ton. Von einem Tag auf den anderen sollten die Charaktere plötzlich sprechen, und das war wirklich eine Herausforderung, denn kein Mensch wusste, was sie zueinander sagen könnten.
„Hallo, Liebling, wie war dein Tag?“
„Ganz gut, und deiner?“
„Auch ganz gut, alles wie immer.“
„Schön.“
„Ja.“
Wer sollte für solchen Quatsch Geld bezahlen? Die Realität interessiert niemanden, davon haben wir selbst alle genug. Nein, die Leute im Film sollten Dinge sagen, die das Publikum nicht alltäglich zu hören bekommt, etwas Originelles – ungewöhnlich, aber nicht exzentrisch, auffällig und doch glaubwürdig. Etwas Wunderschönes sollten sie sagen.
Und so kam es zur Entstehung der Wortkombination, die der Unterhaltungsindustrie im 20. und 21. Jahrhundert den größten Umsatz einbringen sollte. Ein Satz, der zum meistzitierten der Filmgeschichte werden sollte, ja vielleicht sogar der Menschheitsgeschichte:
I love you.
Das war der Hammer. Die Leute drängten sich an den Toren der Filmstudios, um ihre Lieblingsschauspieler die magischen drei Worte sagen zu hören, in genau dieser Reihenfolge, ein ums andere Mal. Egal, wie oft sie es hörten, sie bekamen nie genug. Das Publikum in aller Welt war zu einer Armee Junkies mutiert, die an ihrer wöchentlichen Dosis Romantik hing.
Ungefähr zur selben Zeit wurde der Kuss neu erfunden. Bis dato beschränkten sich die Leute darauf, ihre Lippen zu vereinen und für ein paar Sekunden in dieser Position zu verharren. Die Mutigsten wagten die Mundhöhlenerforschung, Zunge an Zunge, abwechselnd oder gleichzeitig. Bis Hollywood beschloss, dass das nicht mehr ausreichte. Es war zu subtil, zu klein für die riesige Kinoleinwand. Dem Alltagskuss musste eine gute Prise Epik hinzugefügt werden, eine neue Kussdimension musste her. Der Kuss war in die Jahre gekommen und musste den Anforderungen der zeitgenössischen Konsumenten angepasst werden.
Also begannen die Schauspieler und Schauspielerinnen, sich auf eine absurd barocke Art und Weise zu küssen, fast choreografiert, die Hand im Nacken des Partners und den Kopf verdreht. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit kam diese unnatürliche Verrenkung beim Publikum äußerst gut an. Sie kam sogar so gut an, dass Jugendliche aller Herren Länder diese Kusstechnik noch immer nachahmen, ohne zu wissen, dass die menschliche Physiognomie einfach nicht darauf ausgelegt ist, eine solche Haltung einzunehmen – geschweige denn, sie zu genießen.
Jetzt stelle man sich noch eine Geige dazu vor, oder zwei, oder zweihundert, eine schummrige Kulisse und, warum nicht, ein bisschen Regen zum Höhepunkt. Alles verrühren und voilà: Schon hat man eine wunderschöne Liebesgeschichte, identisch mit allen anderen auf diesem Planeten.
In gewisser Weise ist es normal, dass wir davon träumen. Wie könnte man sich so etwas auch verwehren? Man steht um sieben Uhr in der Früh auf, es ist keine Milch im Haus, man entdeckt ein neues graues Haar, der Chef ist immer noch ein Idiot und das Zehnuhrmeeting war schon um neun. Wie sollte man da nicht von Geigen und Küssen in exotischen Gefilden träumen? Ist uns das der Kosmos nicht etwa schuldig? Nicht die Liebe bewegt die Welt, sondern unsere Illusion, die große Liebe wie eine Hollywoodfigur zu erfahren.
Das kann natürlich nur Enttäuschung erzeugen, aber wir leben schließlich in der westlichen Welt, wo ein jeder das Recht auf die Enttäuschung seiner Wahl hat. Alle wissen, dass diese Geschichten irreal sind, wir wissen es genau und ignorieren es zugleich, denn nur so kann das Placebo wirken. Wir wachsen und altern mit einer romantischen Fantasie als Fixpunkt, weil wir daran glauben müssen, dass es mehr gibt als Outlook und den nächsten Milchkaffee. Etwas Besseres und Schöneres als die langen, grauen Gesichter der Menschen, die man tagtäglich in der U-Bahn sieht, Monat für Monat, Jahr für Jahr, und die man nicht grüßt, weil sie einen auch nicht grüßen. Etwas Aufregenderes als das Brathähnchen mit Salat und die wöchentliche Pilatesstunde.
Es gibt keinen einzigen Menschen, der gegen diese Fantasie gefeit wäre. Aber die Zeit vergeht, die Haare werden grauer, das Fleisch wird schlaff, und früher oder später muss ein jeder sich die Frage stellen: Wie lange will ich noch auf das Geigenkonzert warten? Oder auch: Wie lange will ich noch an Märchen glauben, bevor ich mir eingestehe, dass das Leben sehr viel prosaischer und langweiliger ist als dieser romantische Quark, den ich seit meiner Kindheit serviert bekomme? Mit zwanzig denkst du, du hast das Leben noch vor dir. Mit dreißig kommen dir langsam Zweifel. Mit vierzig schluckst du Pillen gegen Schlafstörungen.
Du beginnst dich zu fragen, ob du vielleicht zu anspruchsvoll bist, ob du deine romantischen Vorstellungen etwas runterfahren solltest, ein bisschen realistischer sein. Du probierst mal so ein Onlineportal aus, verabredest dich mit ein paar Kandidaten, aber alle wirken entweder sehr traurig oder regelrecht psychopathisch, also löschst du die App wieder vom Smartphone. Und dann, eines Morgens, bleibt dein Blick an dieser Person aus dem Büro hängen, und du denkst: Mal sehen, vielleicht könnte ich mit diesem Menschen alt werden. Na ja, warum auch nicht? Es ertönen zwar keine Geigen, wenn du sie ansiehst, aber das Leben währt schließlich nicht ewig, und sie (oder er) ist nun wirklich nicht übel. Sie raucht nicht, und manchmal bringt sie dich zum Lachen. Vielleicht nur ein wenig, aber du suchst schließlich keinen Comedian, sondern etwas halbwegs Warmes zum Ankuscheln in der Nacht. Jemanden, der dich zum Arzt begleitet, wenn du die Ergebnisse der Routineuntersuchung bekommst, der dir sagt, dass es noch andere Arbeitsplätze gibt, wenn du deinen verlierst, der an dich glaubt oder zumindest glaubhaft vorgibt, es zu tun, wenn du selbst nicht mehr an dich glaubst.
Verglichen mit der Romantik Hollywoods sind Liebesgeschichten aus dem echten Leben in etwa die Hügel in der Skihalle verglichen mit dem Mount Everest. Natürlich würdest du gerne den höchsten Berg der Welt bezwingen, wer träumt nicht von so einer Erfahrung? Aber der Mount Everest ist echt weit weg, du hast viel zu tun, und, was soll’s, der Kunstschnee erfüllt seinen Zweck auch ganz gut. So groß wird der Unterschied schon nicht sein.
Oder?
Ich will nicht behaupten, dass Hollywood die Schuld an all den emotionalen Sorgen der Weltbevölkerung trägt. So naiv bin ich nun auch nicht. Aber man kann festhalten, dass das Kino eine Fantasie demokratisiert hat, die wir seit … keine Ahnung, schon immer mit uns herumschleppen, nehme ich an.
Wenn man mal einen Blick auf die Geschichte wirft, die Weltgeschichte, meine ich, stolpert man über einen Haufen Menschen, und darunter sehr schlaue, die gegen diese Mauer der Irrealität gestoßen sind. Beethoven zum Beispiel, den man doch wohl für eine ernsthafte Persönlichkeit halten kann, hat sein berühmtestes Stück, Für Elise, einer Frau gewidmet. Er hoffte vermutlich, wenn er ihr ein Meisterwerk widmet, lädt sie ihn vielleicht mal auf einen Kaffee oder ein Bier ein, oder was auch immer die Leute im Wien des 19. Jahrhunderts so tranken.
Da täuschte er sich natürlich. Sie hat ihn überhaupt nicht beachtet. Stellen Sie sich das mal vor: Sie komponieren eines der schönsten Stücke der Musikgeschichte, widmen es einer Dame, und was macht sie? Heiratet einen Staatsdiener.
„Aber Elise, ich habe dir die entzückendste Bagatelle für Klavier gewidmet, die je geschrieben wurde!“
„Mein Gott, Ludwig, wer hat dich schon darum gebeten?“
„Niemand, aber …“
„Eben, niemand. Also hör auf, dich lächerlich zu machen. Ich hab dir oft genug gesagt, dass du nicht mein Typ bist. Ich kann mit kreativen Genies echt nichts anfangen, ich steh mehr auf Beamte.“
Ich vermute, dass Elise eine gewisse Stabilität anstrebte, die sie an der Seite eines langhaarigen Musikers nicht erwarten konnte. In dieser Hinsicht sind wir heute auch nicht viel weiter.
Egal, ob man in der hohen oder der niederen Kultur sucht, in elitären oder in Massenmedien, wenn man nur ein bisschen gräbt, wird man einen ziemlichen Batzen triefenden und inkongruenten Romantizismus aufstöbern. Sogar in etwas so Profanem wie einem Computerspiel. Ich meine, ist es wirklich nötig, dass Super Mario mit allem, was er tut, die Rettung einer Prinzessin anstrebt? Braucht ein Klempner, der Mauern mit dem Kopf durchstoßen kann und gegen anthropomorphe Pilze kämpft, ernsthaft eine romantisch motivierte Daseinsberechtigung?
Wir sind umzingelt, und es gibt kein Entkommen. Gucken Sie sich nur mal die Bestsellerlisten an: eine Liebesgeschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, eine Liebesgeschichte aus der Nachkriegszeit, eine Liebesgeschichte aus dem letzten Monat … Immer das gleiche Schema, ein ums andere Mal:
1. Mann lebt gewöhnliches Leben und träumt von der Liebe, ohne sie zu finden.
2. Mann lernt Frau kennen, als er es am wenigsten erwartet, und – verwirrt von all den romantischen Filmen und Liedern und Computerspielen, in denen ein Klempner Mauern mit dem Kopf einreißt, um eine Prinzessin zu retten – wirft sich ihr zu Füßen.
3. Küsse, Schmetterlinge etc.
4. Frau bemerkt, dass Mann ein Idiot ist, was wiederum zum scheinbar endgültigen Bruch führt, aber jeder weiß, dass das nicht sein kann, weil man erst bei der Hälfte des Romans angekommen ist.
5. Mann versinkt in Melancholie, als er feststellt, dass er nicht ohne die Frau leben kann, was ihn nach einer Phase schmerzhaften Selbstmitleids dazu bringt, für die Rückeroberung seiner Liebe zu kämpfen.
6. Frau verzeiht Mann, auch wenn er ein Vollidiot ist, vermutlich, weil es Schlimmeres gibt als Idiotie. Unnatürliche Nackenverrenkung, Violinencrescendo und Abspann.
Man vergleiche dieses Schema mit jedweder Liebesgeschichte, die man gesehen oder gelesen hat.
Und jetzt vergleichen Sie es mit Ihrem Leben.
Die romantische Liebe ist und bleibt eine Form der Flucht. Ein Zeitvertreib, wie Fernsehshows oder Sudokus, nur viel komplexer und eben deshalb auch viel unterhaltsamer. Wir schlagen die Zeit tot, indem wir uns verlieben und trennen, im Liebeskummer versinken und neue Hoffnung schöpfen, nur um der enormen Menge an realen Problemen zu entkommen, die da draußen auf uns warten. Wir lieben einander, um uns nicht dem komplett Unbegreiflichen zu widmen, das uns sonst umgibt.
Beethoven ist übrigens in Altersarmut gestorben.
Und allein.
Kapitel 2
Ich heiße Daniel wie mein Vater und wie sein Vater vor ihm. Unschwer zu erkennen, dass ich aus einer Familie ohne Einfallsreichtum in der Namensgebung komme.
Ich bin fünfunddreißig Jahre und einen Monat alt: zu alt für kindliche Fantasien und zu jung, um sie aufzugeben. Außerdem bin ich Absolvent eines Journalismusstudiums, wobei ich zu meiner Verteidigung sagen kann, dass ich nie praktiziert habe.
Die vier Jahre meines Studiums habe ich schwarz gekleidet und mit einer Zigarette im Mundwinkel verbracht. Das schien mir der direkteste Weg, Schriftsteller zu werden, was meine kindliche Fantasie war und auch meine erwachsene geblieben ist. Wie alle Jugendlichen dachte ich, Schein ist der erste Schritt zum Sein. Zum Glück habe ich das mit der Zeit überwunden. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Manch einer läuft mit vierzig noch als sein Wunschtraum verkleidet herum. Das ist wirklich armselig.
Seit ich denken kann, schreibe ich alles auf, was mir in den Sinn kommt. Alles: Gedanken, Gefühle, Eindrücke. Man könnte sagen, das hilft mir dabei, die Welt zu verstehen. Manche zeichnen, laufen ständig mit einem Notizbuch herum und skizzieren alles, was sie sehen. Ich mache das auch, nur mit Worten. Das ist meine spezielle Therapie, günstiger als ein Psychologe und genauso effektiv (ergo: völlig ineffektiv). Bis heute ist die einzig messbare Konsequenz dieser Praxis ein gutes Dutzend Notizbücher, die ich bei jedem Umzug mitschleppe, ohne zu wissen, warum oder wie lange noch.
Müsste ich einen Moment in meinem Leben benennen, der mich als die Person charakterisiert, die ich heute bin, würde ich zweifelsfrei den Tag wählen, an dem ich mein erstes blaues Hemd kaufte. Ein Hemd, das niemandem auffällt, die Art Kleidungsstück, die jeglicher Persönlichkeit entbehrt. Ein durch und durch gewöhnliches Hemd, von gewöhnlichem Schnitt, mit gewöhnlichem Kragen und völlig gewöhnlichen weißen Knöpfen.
Jemand, der den psychologischen Gehalt verkennt, welcher den Details unserer Existenz innewohnt, könnte das als nebensächlich abtun, als unwürdig, ein Menschenleben in seiner ganzen Komplexität abzubilden. Aber er irrte, natürlich. Für mich war der Kauf dieses Hemdes vor nunmehr gut zwei Jahren ein wirklich existenzieller Meilenstein. Die Spartaner ließen ihre Kinder eine Nacht lang allein unter freiem Himmel schlafen. Jene, die überlebten, kehrten als Erwachsene ins Dorf zurück. Ich verließ eines Tages das Haus in einem Shirt mit „Stay Cool“-Aufdruck und kehrte mit einem nichtssagenden blauen Hemd zurück.
Für einen Mann geht das Tragen eines solchen Hemdes mit dem Eingeständnis der eigenen Bedeutungslosigkeit einher, mit der Bekenntnis zur eigenen Irrelevanz unter den sieben Milliarden Menschen, die diesen Planeten bevölkern. Dieses vollkommen gewöhnliche Hemd, ununterscheidbar von anderen Hemden, ist das große Symbol der männlichen Selbstakzeptanz, eine Flagge, die in die Welt posaunt: „Ich bin nichts Besonderes, und weißt du was? Ich habe es akzeptiert.“ Vertrauen Sie nie einem Mann über dreißig, der nicht wenigstens ein blaues Hemd im Schrank hat.
Am Anfang fühlte ich mich verkleidet. Sogar ein bisschen niedergeschlagen. Das ist ganz normal, niemand geht gerne mit seiner eigenen Nichtigkeit hausieren. Ich betrachtete mich im Spiegel und fragte mich, wer dieser traurige und ausdruckslose Typ war, dessen Antlitz mir entgegenblickte. Ich dachte: „Was für ein ungeeignetes Kleidungsstück für einen Schriftsteller, der doch ein Mensch mit gehaltvollem Inneren ist, ein komplexes Knäuel aus Gedanken und Ideen über die Welt, überaus eigensinnig, analytisch, brillant …“ Heute besitze ich vier blaue Hemden und ziehe kaum noch etwas anderes an.
So sieht es aus: Das bin ich. Einer dieser Typen in blauen Hemden, die einem tagtäglich begegnen. Weder besonders gut aussehend noch besonders unansehnlich, Größe eins vierundachtzig, Haare dunkelbraunfastschwarz. Ein fünfunddreißgjähriger Typ im fortgeschrittenen Selbstakzeptanzstadium. Soll das heißen, dass ich die Vorstellung aufgegeben habe, meinen Namen auf ein Buch gedruckt und in den Händen von Literaturstudenten zu sehen? Natürlich nicht. Aber ich habe gelernt, die Dinge langsam anzugehen. Sie zu nehmen, wie sie kommen. Außerdem habe ich noch keine Geschichte aufgetan, die es wert wäre,
Mein erster Roman
(Arbeitstitel)
zu werden.
Für all die Schriftsteller, die eine traumatische Kindheit hinter sich haben oder einen Krieg oder eine Hungersnot, ist das natürlich wesentlich einfacher. Sie brauchen nur die Leere, die aufgrund des Erlebten in den Tiefen ihrer Seele schlummert, hervorzulocken und sie auf ein Punkt doc zu bannen. Ich bin leider nicht so gesegnet. Meine Kindheit war ziemlich glücklich. Na ja, auch nicht übermäßig. Gewöhnlich, nehme ich an. Als ich mir ein Fahrrad wünschte, kauften meine Eltern mir eines. Später wollte ich eine Gitarre und bekam eine (ich spielte darauf exakt eine Woche lang, wobei spielen als relativ maßloses Verb für die beschriebene Tätigkeit gelten kann). Ich wollte Karate machen und tat es, bis mein Vater verstand, dass er dafür bezahlte, dass die Jungs aus der sechsten Klasse seinen Sohn zweimal wöchentlich vermöbelten. Also wechselte ich zur Theater-AG, wo zumindest kein Blut floss. In der siebten Klasse spielte ich Hamlet, und meine Mutter fand mich sehr witzig. Ja, das sagte sie: „sehr witzig“. Was, zum Teufel, soll jemand wie ich schon schreiben?
Der aufregendste Moment meines Lebens lässt sich auf die Silvesternacht 2008 datieren, als ich bis fünf Uhr morgens sternhagelvoll bei mir zu Hause im Fahrstuhl feststeckte und mich schließlich unsere Nachbarin rettete. Nicht gerade Krieg und Frieden.
Aber ich gebe nicht auf. Ich glaube daran, dass ich eines Tages eine Geschichte entdecken werde, die es wert ist, mein Erstlingswerk zu werden. Dieses unerschütterliche Vertrauen in meine Zukunft vermag allerdings nicht meinen Vermieter zu überzeugen, weshalb ich einen provisorischen Plan B austüfteln musste. Und so kam es, dass ich meinen Lebensunterhalt mit Biografien bestreite.
Ich nenne sie Biografien, weil das ernsthaft und respektabel klingt, aber ehrlicher wäre es, sie Firmengeschenke zu nennen. Es handelt sich um einen dieser albernen Trends „made in USA“, so wie Halloween, Muffins oder die Atombombe. Man denke sich eine große Firma, deren zu gleichen Teilen geliebter wie gefürchteter Big Boss in Rente geht. Der Vorstand versammelt sich, denn dazu ist der Vorstand da, und beschließt einstimmig, dass der Big Boss zum Zeichen der Anerkennung für seine selbstlosen Verdienste ein Geschenk erhalten soll. In alten Zeiten hätte die Sekretärin eine goldene Armbanduhr mit Gravur besorgt und fertig. Doch eines Tages dachte sich ein US-Amerikaner: „Hey, wie wär’s, wenn wir einen Journalisten bitten, eine Biografie des großen Mannes zu schreiben? Das wäre doch ein fantastisches Geschenk! Und so viel persönlicher als eine goldene Rolex! Bestimmt auch wesentlich günstiger!“
Es handelt sich jedoch aus einem triftigen Grund nicht um authentische Biografien. Die Wahrheit hat immer ein hässliches Gesicht, und dieses Gesicht will niemand sehen. Schon gar nicht der Beschenkte. Demzufolge ist es das alleinige Ziel, es dem vorgeblich Biografierten zu ermöglichen, sich zwei oder drei Tage lang in seiner vermeintlichen Größe zu baden, während er sich auf dem Sonnendeck seiner Jacht aalt und sich allmählich mit seinem neuen, beschäftigungslosen Lebensabschnitt vertraut macht.
All das habe ich vor ungefähr vier Jahren entdeckt, in einem Blog für gescheiterte Schriftsteller, den ich regelmäßig lese. Zu jener Zeit lebte ich mehr schlecht als recht davon, Werbemüll zu produzieren, also schien mir die Prostitution meiner Feder im Dienste großer Unternehmen eine exzellente Möglichkeit zu sein, meinem Konto ein wenig Luft zum Atmen zu verschaffen, während ich auf den schriftstellerischen Geistesblitz wartete. Ich erstellte ein Dossier, um meine Dienste mit einigen Schriftproben anzubieten, ließ es binden und klapperte die Presseabteilungen von fünf Dutzend Unternehmen ab. Zu meiner Überraschung schrieb ich bereits einen Monat später Leben und Wundertaten des Besitzers einer Juwelierkette nieder.
Ob das ein toller Job ist? Ganz sicher nicht. Es ist langweilig, undankbar und kreativitätskastrierend, aber immerhin habe ich keine Vorgesetzten (zumindest nicht im herkömmlichen Sinn des Wortes) und bin Herr meiner Zeit. Im Klartext heißt das: Ich kann mehr Stunden im Pyjama als in Jeans verbringen und muss niemandem Rechenschaft ablegen, wenn ich Lust habe, ausgerechnet an einem Mittwochvormittag spazieren zu gehen.
Der Arbeitsprozess ist immer der gleiche. Das Unternehmen lässt mir Informationen über seinen Chef zukommen: Interviews, Briefe, Fotos – alles, was sie haben. Dem füge ich Details hinzu, die ich im Internet finde, sowie fünf oder sechs Interviews, die ich selbst mit Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Freunden und Verwandten des Porträtierten führe. Die Interviews sind wichtig, weil sie mir ermöglichen, sechzig Prozent des Buches mit copy and paste zu füllen. Sobald ich das Material beisammenhabe, schließe ich mich eine Woche lang mit ein paar Kilo Kaffee und zwei Dutzend Tütensuppen in meiner Wohnung ein. Der gesamte Dokumentations- und Redaktionsprozess nimmt in der Regel zwei bis drei Monate in Anspruch, wobei ich vorgebe, sechs zu brauchen, um mein Honorar zu rechtfertigen. Ich schätze, wenn ich wirklich ambitioniert wäre, könnte ich den Arbeitsprozess noch straffen und eine Pseudobiografie pro Woche schreiben (wobei natürlich zu bezweifeln ist, dass irgendjemand sehr lange von Kaffee und Tütensuppe allein leben kann).
Lope de Vega, einer der großen spanischen Dichter und Dramaturgen des Goldenen Zeitalters, schrieb sieben Romane, neun Heldengedichte, dreitausend Sonette und, Achtung, eintausendachthundert Theaterstücke. Das klingt ja so schon sehr beeindruckend, aber noch beeindruckender wird es, wenn man seine Produktivität berechnet. Lope hat dreiundsiebzig Jahre lang gelebt. Nehmen wir einmal an, er habe mit zwanzig zu schreiben begonnen und mit siebzig aufgehört. Macht fünfzig Jahre literarischer Produktion, was bedeutet, dass der Mann sechsunddreißig Theaterstücke im Jahr schrieb. Also fast ein Stück pro Woche. Und noch immer blieb ihm genug Zeit, zwischendrin ein paar Heldengedichte, Romane und Sonette aus dem Ärmel zu schütteln. Wenn meine Kunden das wüssten, würden sie mir eine Woche geben und die Biografien in Versform verlangen.
Glücklicherweise interessiert sich der prototypische PR-Manager eines großen Unternehmens nicht im Geringsten für Lope de Vega. Das Einzige, was diese Leute wollen, ist, dass ihr beinahe Exchef als der große Mann porträtiert wird, der er glaubt zu sein. Das ist natürlich nicht immer einfach. Manchmal muss man sich wirkliche Korkenziehersätze aus den Rippen schneiden, um über diese oder jene Episode hinwegzukommen. Wenn zum Beispiel der Porträtierte in den Neunzigerjahren die Hälfte der Belegschaft entlassen hat (seinerzeit durchaus üblich), schreibe ich, dass er „sich gezwungen sah, Umstrukturierungen vorzunehmen, um die Firma wettbewerbsfähig zu halten“. Nichts, was Journalisten nicht genauso täten, um es uns tagtäglich als Information zu verhökern. Der Unterschied ist, dass in meinem Fall der einzig Betrogene der Protagonist selbst ist. Es gefällt mir zu denken, dass ich ein neues literarisches Genre erschaffen habe, eine personalisierte Form des Ratgebers. Ich nenne es Selbstbetrugsliteratur.
Diese Geschichte beginnt ausgerechnet in der Empfangshalle eines solchen Unternehmens: Immobilien Monteis mit Sitz in der Gran Vía in der Madrider Innenstadt. An einem Montag um fünf nach acht sitze ich hier und blättere eine Zeitschrift mit dem Titel Zement und Glas durch, als eine Sekretärin zwischen fünfzig und hundertzwanzig Jahren mich bittet, ihr ins Büro des Herrn Portabella zu folgen.
„Wenn Sie so freundlich wären“, sagt sie, und ich bin so freundlich, selbstredend.
Mit dem Herrn Portabella, dessen Vorname Albert ist, habe ich bisher zweimal telefoniert und sechs E-Mails ausgetauscht. Er ist der PR-Manager der Firma, und das Treffen heute ist reine Formsache, davon gehe ich jedenfalls aus. Ein paar Details klären, Vertrag unterschreiben, Händedruck, fertig.
Ich folge der Sekretärin durch die fünf Stockwerke des Firmengebäudes. Hier steckt viel Geld drin, und das soll man sehen. Auf dem Weg in die Chefetage kreuzen wir die niederen Ränge, wo die Mitarbeiter mit schlafverklebten Augen gerade ihre Computer hochfahren. Vielstimmig ertönt die Windows-Startmelodie, die Hymne unserer Zeit. Ein Gähnen, ein Telefonklingeln, Gesprächsfetzen zwischen Kollegen. Fast alle verfolgen mich mit Blicken. Sobald ich außer Sichtweite bin, werden sie sich gegenseitig fragen, wer wohl dieser Typ in dem ordinären blauen Hemd war und was er hier zu suchen hat zu dieser unchristlichen Uhrzeit.
Die Frau undefinierbaren Alters öffnet eine Tür und verkündet: „Albert, der Herr Durán ist hier.“
Der Herr Durán bin natürlich ich, und ich gebe mich zu erkennen, indem ich ihm die Hand entgegenstrecke und „Guten Morgen, sehr erfreut“ sage, was er mit exakt denselben Worten beantwortet. Dann schickt er ein Lächeln hinterher, das eine blitzblank polierte Zahnreihe zum Vorschein bringt. Es ist nicht das erste Mal, dass ich ein derart weißes Gebiss zu Gesicht bekomme, und jedes Mal frage ich mich, wie diese Leute solche Makellosigkeit zustande bringen. Die Sekretärin schließt die Tür hinter sich und lässt mich mit dem PR-Manager allein.
Portabellas Büro ist einer dieser kühlen und hässlichen Räume, wo jegliche Persönlichkeit, die man ihm unterjubeln will, nichts ausrichten kann, er wird immer kühl und hässlich bleiben. Mit schnellem Blick erfasse ich: eine Kinderzeichnung von Mama und Papa, ein paar Pokale und eine Reihe Zeitschriften, vermutlich die gesammelten Ausgaben von Zement und Glas. Auf dem beinahe leeren Schreibtisch: ein Bildschirm, ein Blatt Papier (richtig: eines!), ein paar Briefumschläge und eine Antistresskugel, die ziemlich unbenutzt aussieht. Portabella ist entweder ein sehr relaxter Typ, oder er hat andere Sublimierungstechniken.
„Schönes Büro!“, lüge ich.
„Finden Sie? Ich kann es nicht ausstehen“, sagt er. „Früher saßen wir in Serrano, in einem spektakulären Palais aus dem 19. Jahrhundert. Dann kam die Krise und – na ja, das Übliche.“
Ich bestätige, ja, sicher, das Übliche.
„Also dann“, sagt Portabella, „ans Werk.“ Er klopft einmal kurz auf den Tisch. „Wir sind uns einig über Honorar und Abgabetermin, nicht wahr?“
„Absolut, ja.“
„Sechs Monate reichen?“
„Ja, das ist kein Problem“, sage ich und denke an Lope de Vega. „Vielleicht geht es auch schneller, aber …“
„Nein“, unterbricht er mich, „sechs Monate sind in Ordnung. Im Januar also. Eduardo … also, Herr Monteis geht im März in Rente, aber wir hätten das Buch gerne mit etwas Puffer. In so einem großen Unternehmen will ja jeder seinen Senf dazugeben, und wenn es nur ist, um zu sagen, man hätte auch seinen Senf dazugegeben.“
Ich grinse, weil ich verstanden habe, dass das ein Witz sein sollte. Dann nimmt Portabella das Blatt Papier vom Tisch und betrachtet es ein paar Sekunden lang mit verlorenem Blick, als würde er über etwas sehr Tiefgründiges nachdenken, den Kosmos, die Unendlichkeit, Gott, so etwas. Als er aus der Trance erwacht, reicht er mir das Blatt.
„Die Liste der Interviewpartner. Es sind fünf, nicht sechs – Sie wollten sechs, oder?“
„Richtig.“
„Nun, es sind nur fünf geworden. Mehr habe ich nicht aufgetan. Ich habe Ihnen die Namen, Durchwahl und Mail-Adressen aufgeschrieben. Alle wissen Bescheid.“
Ich werfe einen Blick auf die Liste, die außerdem noch die Posten der Bezeichneten im Unternehmen vermerkt, etwa „Leiterin des Departments für Internationalisierung“ oder „Mitglied der Aktionärsversammlung“. Sieht aus, als hätte dieser Monteis außerhalb der eigenen Firma nicht besonders viele Freunde.
„Gut“, sage ich, denn Kritik sollte man immer mit einer positiven Bemerkung einleiten. „Aber ich müsste auch mit jemandem aus der Familie sprechen. Und nach Möglichkeit auch mit einem Freund.“
„Ja, das sagten Sie schon, aber das ist wirklich alles, was ich erreichen konnte. Und das war nicht gerade leicht. Damit werden Sie auskommen müssen. Ist das ein Problem?“
„Nein, es wird schon reichen. Aber die Familie bringt einfach immer eine andere Perspektive mit rein. Persönliche Anekdoten, Ferienerlebnisse, solche Sachen.“
„Verstehe“, sagt er und setzt dieses Gesicht auf, das viele Leute haben, wenn sie sehr stark nachdenken: die Unterlippe zwischen die (wirklich übertrieben weißen) Zähne geklemmt, die Augen zusammengezogen. Ich warte ein paar Sekunden ab, dann entschließe ich, ihm zur Hilfe zu kommen, bevor ihm die große Denkanstrengung noch die Gefäße verstopft.
„Hat der Herr Monteis denn keine Familie?“
„Nein. Seine Frau ist schon vor Jahren gestorben. Er hat eine Tochter, Eva, aber sie haben keinen Kontakt.“
„Oh.“
Pause. Er sieht ins Leere, ich warte.
„Na ja“, sagt er, „ich könnte es versuchen … Ist es sehr wichtig?“
„Es wäre nicht schlecht“, sage ich und präzisiere umgehend: „Es ist sehr wichtig, ja.“
Vor allem für mich. Ich weiß aus Erfahrung, dass die Familie immer das meiste und das beste Material liefert. Die Partner, Mitarbeiter und Untergebenen beschränken sich auf das Herunterleiern von Gemeinplätzen, wenig Verwertbares, was mich dann zwingt, die Löcher zu stopfen (ergo, mehr Arbeit). Aber gib mir nur ein Familienmitglied, und ich fülle im Handumdrehen zwanzig Seiten.
„Um ehrlich zu sein, habe ich sie nicht mal angerufen“, sagt Portabella. „Ich bin von vornherein davon ausgegangen, dass sie Nein sagen würde, aber … Na ja, das Thema Tochter ist ein ziemliches Tabu für Monteis. Ich kann Ihnen nichts versprechen. Wie lang würde dieses Interview dauern?“
„Eine Stunde.“
„So lang?“ Er sieht mich verzweifelt an.
„Halbe Stunde. Vierzig Minuten“, lenke ich ein, obwohl ich nicht wirklich verstehe, warum ich mit diesem Typen verhandele, es könnte ihm herzlich egal sein.
„Okay, folgender Vorschlag.“ Er zieht einen USB-Stick aus seiner Hemdtasche. „Nehmen Sie das mit. Ich hab Ihnen alle Interviews mit Monteis draufgezogen, die ich finden konnte, plus ein paar Reportagen aus dem Archiv. Das Material geht bis in die Neunziger zurück, da sollten Sie genug Stoff haben.“ Das würde ich lieber selbst beurteilen, aber ich halte den Mund. „Ich kümmere mich um seine Tochter und melde mich so bald wie möglich bei Ihnen.“
Dann unterschreibe ich einen dreiseitigen Vertrag, dessen Vertraulichkeitsklausel allein eineinhalb Seiten umfasst, und stecke mein Exemplar ein.
„Gut“, sagt Portabella und erhebt sich, „das wär’s dann.“
Er besteht darauf, mich zum Fahrstuhl zu geleiten, obwohl ich ihm sage, dass das nicht nötig sei. Auf dem Weg kommentiert er die angenehmen Temperaturen; besser als der letzte Sommer, in dem es so furchtbar heiß war. Ich: „ja“, er: „uff“. Und die Leute, die mich auf dem Hinweg angestarrt haben, starren jetzt wieder.
Am Fahrstuhl angekommen, reicht Portabella mir die Hand, und ich ergreife sie mit dem hoffentlich letzten forcierten Lächeln des Tages.
„Das wird bestimmt ein großartiges Buch“, sagt er.
„Ja“, sage ich.
Lope de Vega, ich komme!











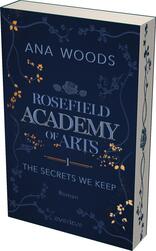




Daniél Durán ist 35 Jahre alt und studierter Journalist. Er träumt davon, einen Roman zu schreiben, aber stattdessen verdient er seinen Lebensunterhalt im Auftrag von Unternehmen mit dem Verfassen von Biographien über scheidende Manager oder Firmeninhaber. Auch wenn ihn die Leben der zu porträtierenden Persönlichkeiten nicht interessieren, ist es für Daniél leicht verdientes Geld, da er eine Bearbeitungszeit von sechs Monaten veranschlagt, tatsächlich aber nur wenige Wochen beschäftigt ist. Sein aktueller Auftrag ist etwas kniffliger, da ihm sein Auftraggeber nur wenige Interviewpartner, von denen er etwas über den Inhaber der Firma erfahren könnte, benennt. Da es sich bei dem Immobilienunternehmer Monteis um keinen beliebten Arbeitgeber zu handeln scheint, ist es für Daniél umso wichtiger, auch mit Familienangehörigen zu sprechen. Die einzige in Frage kommende Interviewpartnerin ist seine Tochter Eva, die den Kontakt zu ihrem Vater vor Jahren abgebrochen hat und sich weigert, an der Biographie mitzuwirken. Daniél, der nach der Trennung von seiner einzigen Liebe Sara, bei der es sich heute um seine beste Freundin handelt, Liebe und Gefühlen abgeschworen hat, ist fasziniert von der resoluten jungen Frau, die wieder Leben in sein monotones Dasein bringt. Daniél hat allerdings nicht nur Probleme, Gefühle zuzulassen, er ist auch gegenüber seinen Mitmenschen wenig empathisch. Unweigerlich verletzt er Eva durch seine direkte und sozial inkompetente Art. Mit seinen unbeholfenen Entschuldigungen kann er Eva auch nicht wieder zurückgewinnen, weshalb er zunächst in ein tiefes Loch fällt und sich noch mehr zurückzieht. Sara schafft es, ihn wieder aufzuraffen und er stürzt sich sodann in die Arbeit. Bei den Recherchen zu Monteis wird er auf dessen skrupellose Machenschaften aus der Vergangenheit aufmerksam, die Daniél wieder Eva näher bringen... "Dies ist keine Liebesgeschichte" ist selbstverständlich nur ironisch gemeint, denn jede Geschichte ist eine Liebesgeschichte - "selbst eine Rachegeschichten denn man rächt sich nur aus Liebe". So wird man in den Roman eingeführt und es sind lauter intelligente Sätze und Bonmots dieser Art, die für sehr vergnügliche Lesestunden sorgen. Der Roman um den sympathischen Einsiedler Daniél ist ironisch-witzig geschrieben und bietet bis zum Schluss aufgrund der lebendigen Dialoge und der skurrilen Eigenarten von Daniél eine sehr gute Unterhaltung. Es ist keine reine Liebeskomödie, sondern auch eine Geschichte um einen jungen Mann, den man zunächst als etwas verschrobenen und pessimistischen Charakter kennenlernt, der sich aber im Verlauf der Geschichte persönlich weiterentwickelt, Interesse für seine Mitmenschen aufbringt und endlich aus der Monotonie des Alltags ausbricht. Voller Situationskomik ist der Debütroman von José A. Pérez Ledo eine intelligent geschriebene (Liebes-)geschichte, die all den Lesern gefallen wird, die "Das Rosie-Projekt" von Graeme Simsion mochten.
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.