
Die Nebel von Connemara — Inhalt
Eine geheimnisvolle Liebe an der malerischen Westküste Irlands
Clara steigt ins Auto und fährt einfach los, ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen zu haben. Selbst als sie auf der Fähre nach Irland ist, weiß sie noch immer nicht, wohin die Reise sie führen wird. Da trifft es sich, dass sie auf der Überfahrt den sympathischen Iren Sean kennenlernt, der ihr verspricht, ihr alles über seine Heimat zu verraten, wenn er sie in seinen Heimatort in Connemara mitnimmt. Clara willigt ein und erlebt auf der Fahrt quer durch ein magisches Irland wunderschöne Tage. Als die beiden schließlich in Carna ankommen, beschließt Clara, noch ein paar Tage in dem verschlafenen Nest zu bleiben. Doch als sie eines Abends ein blinkendes Licht auf der nicht weit entfernt liegenden Insel Feenish sieht, ahnt sie nicht, dass sich ihr Schicksal schon bald entscheidend wenden wird. Denn die Insel ist seit Jahrzehnten unbewohnt, die von Wind und Wetter zerstörten Häuser nur noch Ruinen – und das Licht dürfte dort nicht sein …
Leseprobe zu „Die Nebel von Connemara“
New York, 1911
„Lassen Sie mich durch!“ Der massige Mann schob das junge Paar, das vor ihm an der Reling stand, grob zur Seite. „Ich will das sehen!“
Den beiden in ihren dünnen Mänteln blieb nichts anderes übrig, als vor ihm auszuweichen, denn die Gesetze hier an Bord waren eindeutig und von niemandem zu ändern. Anders als sie, reiste dieser Passagier ganz sicher nicht in der dritten Klasse, das zeigten schon sein warmer Mantel mit dem dicken Pelzkragen und die Schuhe aus feinem Leder, die kaum Gebrauchsspuren zeigten. Sie mussten ihm ihren Platz an der [...]
New York, 1911
„Lassen Sie mich durch!“ Der massige Mann schob das junge Paar, das vor ihm an der Reling stand, grob zur Seite. „Ich will das sehen!“
Den beiden in ihren dünnen Mänteln blieb nichts anderes übrig, als vor ihm auszuweichen, denn die Gesetze hier an Bord waren eindeutig und von niemandem zu ändern. Anders als sie, reiste dieser Passagier ganz sicher nicht in der dritten Klasse, das zeigten schon sein warmer Mantel mit dem dicken Pelzkragen und die Schuhe aus feinem Leder, die kaum Gebrauchsspuren zeigten. Sie mussten ihm ihren Platz an der Reling überlassen. Momentan konnte aber nicht einmal das ihr Glück trüben, denn sie hatten es geschafft. Jetzt würde ihr neues Leben beginnen.
Der Mann drängte sich schnaufend an ihnen vorbei und stellte sich breitbeinig vor sie, während er seinen Blick auf die langsam im grauen Morgennebel auftauchende Freiheitsstatue richtete.
„Wurde aber auch Zeit“, knurrte er vor sich hin. „Ich habe schon gedacht, dass wir niemals unser Ziel erreichen. Wer auch immer behauptet, diese Schiffe seien Meisterwerke der Konstruktionskunst, ist noch nie auf einem gereist.“
Das Pärchen sah sich überrascht an. „Entschuldigung, reden Sie mit uns?“, fragte der junge Mann vorsichtig nach und hustete kurz. Sein dünner Schnurrbart zitterte in der kalten Morgenluft. „Wir finden nämlich, dieses Schiff hat uns außerordentlich sicher über den Atlantik gebracht. Immerhin mussten wir nicht fürchten, dass uns ein Sturm auf den Grund des Meeres schickt …“
„Das ist doch wohl das Mindeste, was man von so einem Schiff erwarten kann, oder etwa nicht?“ Der reiche Passagier würdigte sie keines Blickes, während er weitersprach, ohne auf eine Antwort auf seine Frage zu warten. „Ich meine, dass es nicht untergeht, ist doch so eine Art Grundvoraussetzung. Wenn du deiner Arbeit nachgehst, dann freut sich dein Chef doch auch nicht, wenn du dabei nicht tot umfällst!“ Der dicke Mann schnaubte verächtlich durch die Nase.
Dann warf er einen letzten Blick auf die näher kommende Statue, drehte sich um und überließ seinen Platz in der ersten Reihe wieder dem Pärchen. „Ich sehe lieber mal nach meinem Koffer.“
Er schob sich ungeduldig durch die Menge an Passagieren am Oberdeck, die allesamt den Hals reckten, um nach den vielen Tagen auf See endlich einen ersten Blick auf das verheißene Land zu erhaschen.
Wenig später machte das mächtige Dampfschiff am Pier von Ellis Island fest und die Reisenden aus der ersten und zweiten Klasse verließen das Schiff mit ihren feinen Koffern und Kisten, die nicht selten von Bediensteten getragen wurden. Auch der kräftige Mann war darunter, allerdings musste er seinen Koffer selbst tragen. Mühselig wuchtete er das große Gepäckstück eine steile Treppe nach oben, bis er vor einem mürrisch dreinblickenden Inspektor stehen blieb, um seinen Namen und vor allem die Geldsumme anzugeben, die er in seinem Gepäck mit sich führte.
„Eamon Devlin. 58 Dollar.“
Der uniformierte Mann an der Sperre für die Immigranten winkte ihn wortlos durch. Wer genug Geld bei sich hatte, um den Vereinigten Staaten von Amerika nicht zur Last zu fallen, der musste an dieser Stelle nicht mit Problemen rechnen.
Der dicke Mann mit seinem Fellkragen war schon längst weitergegangen und in der großen Halle verschwunden, als das junge Paar vor dem Inspektor auftauchte. Auf dem für die Jahreszeit viel zu dünnen Mantel des jungen Mannes prangte ein schnell mit Kreide hingeschmiertes Zeichen: ein „E“. Der junge Mann hatte wegen des Gedränges nicht einmal gemerkt, dass ihm da jemand etwas auf den Stoff geschrieben hatte. Jetzt sorgte dieser eine Buchstabe allerdings dafür, dass der Inspektor in Richtung der Quarantänestation deutete. „Hier müssen Sie sich von Ihrer Frau trennen, Mister. Wenn Sie wieder gesund sind, können Sie sich später an Festland treffen.“
„Aber ich kann meinen Mann doch nicht …“, fing die Frau an zu widersprechen, als die Menge sie auch schon weiterschob und ihr Mann sie überrascht ansah, während sich der Abstand zwischen ihnen mit jedem Atemzug vergrößerte. Schnell machte sie einen großen Schritt auf ihn zu, streckte die Hand nach ihm aus und berührte ihren Mann, der auch seine Hand nach ihr ausstreckte, noch einmal kurz an den Fingerspitzen. Dann wurde sie von den anderen Passagieren unsanft weitergeschoben und sah zu, wie ihr Mann in der Quarantänestation verschwand. Jetzt war sie allein mit ihrem schweren Seesack und dem Korb, den sie mit so viel Sorgfalt in Donegal gepackt hatte. Sie musste erst einmal ohne ihn zurechtkommen.
Die junge Frau wusste nicht, dass ihr Mann das Festland von Amerika niemals erreichen würde. Sie hatte keine Ahnung, dass dieser ihr letzter gemeinsamer Augenblick gewesen war.
Eamon Devlin war zu diesem Zeitpunkt schon fast auf der Fähre, die ihn endgültig nach Manhattan bringen würde. Zu seinem neuen Leben, einem Leben ohne die Erinnerungen an den kleinen Ort in Connemara, aus dem er stammte. Ein Leben ohne die beständige Angst, dass ihm sein Reichtum wegbrechen könnte. Ein Neuanfang. Er freute sich darauf. Sehr sogar. Endlich hatte er alles hinter sich gelassen, was ihn belastete. Er lächelte.
Als er wenig später über die Landungsbrücken schritt, wartete dort niemand auf ihn. Rings um ihn herum wurden die Menschen, mit denen er während der Überfahrt noch an einem Tisch gesessen hatte, zu Fremden, die von ihren Verwandten und Freunden überschwänglich begrüßt wurden. Tränen, Gelächter und überall die vertraute irische Sprache.
Keiner achtete auf ihn, als er sich konzentriert umsah. Er brauchte zunächst einmal eine Wohnung und natürlich eine einträgliche Arbeit. Hier an den Landungsbrücken trieben sich genügend Menschen herum, die den neuen Einwanderern ihre Hilfe anboten. Gegen Geld natürlich. Aber Eamon war entschlossen, seinen Weg zu machen. Dazu würde er allerdings zumindest in der Anfangszeit einen Helfer brauchen, am besten einen, der ihn nicht betrügen würde. Aber seine Menschenkenntnis würde ihn in der neuen Welt sicher nicht verlassen.
Als er seinen Blick auf der Suche nach einem vertrauenswürdigen Gesicht über die Menschenmenge schweifen ließ, meinte er für einen Augenblick, ein vertrautes Gesicht unter einer grauen Tweedkappe entdeckt zu haben – aber noch bevor er sich vergewissern konnte, dass er sich nicht getäuscht hatte, war der Mann auch schon verschwunden. Eamon schüttelte den Kopf. Das war unmöglich. Von allen Menschen aus Irland – dieser konnte nicht hier am Pier stehen. Da war er sich sicher. Unglaublich, welche Streiche einem die Phantasie doch manchmal spielte. Die Reise hatte ihm offenbar doch mehr zugesetzt als gedacht.
„Kann ich helfen, Sir? Suchen Sie eine Wohnung?“ Ein junger Mann, fast noch ein Junge, stand neben ihm und sah ihn fragend an. Er hatte kaum Bartwuchs, nur ein leichter roter Flaum zierte seine Oberlippe. Dieser Knabe mit den kindlich blauen Augen und der pickligen Haut würde ihn kaum über das Ohr hauen.
„Ja. Kannst du mir zeigen, wo ich etwas finden kann? Für den Anfang kann es ruhig eine kleine Wohnung sein.“ Eamon lächelte zufrieden.
„Sicher“, nickte der Junge, drehte sich um und pfiff gellend zwischen zwei Fingern. „Ich kümmere mich um einen Wagen, der uns hinbringen kann.“
Sein Pfiff sorgte dafür, dass eine der Kaleschen, die am Straßenrand standen, anfuhr und vor ihnen hielt. Der Junge half, den schweren Koffer auf dem Dach zu verstauen, und lächelte Eamon breit an. Eine Zahnlücke sorgte dafür, dass er wie einer der Lausbuben aussah, die in Eamons Laden in Irland regelmäßig nach Zuckerbrocken gefragt hatten.
Wenige Augenblicke später ruckelte der Wagen los. Zufrieden sah Eamon auf die anderen Immigranten zurück. Bis diese Würmer endlich in der Stadt waren, würde er schon seine erste Wohnung beziehen. Er hatte keine Zeit zu verlieren. Er wollte Amerikaner werden, an dem Reichtum dieser jungen Nation teilhaben, das alte Irland endgültig hinter sich lassen.
„Junge! Ich möchte nicht in dem Viertel der Iren wohnen“, erklärte er. „Ich möchte dort leben, wo die echten New Yorker wohnen. Kannst du mir da helfen?“
Ein überraschter Blick von der Seite war die Antwort. „Nicht bei den Iren?“, fragte der Junge nach. „Sicher?“
Ob er sicher war? Ja. Die eigene Sprache, die Lieder und die Erzählungen aus der alten Heimat würden ihm bestimmt nicht fehlen. Auch auf den angeblich so starken Zusammenhalt, den diese armen Leute einander gaben, konnte er getrost verzichten. Und die einzige katholische Kirche der Stadt konnte er sonntags trotzdem besuchen.
„Ich will keine Erinnerungen, ich will nach vorne sehen“, erklärte Eamon selbstbewusst. „Iren hatte ich in der ersten Hälfte meines Lebens ausreichend um mich herum. Jetzt wird es Zeit für die Amerikaner.“
„Wie Sie meinen, Sir.“ Der Junge wandte sich an den Kutschfahrer. „Bringen Sie uns hinter den Central Park.“ Er lächelte Eamon wieder an. „Da leben keine Iren. Aber es kann sein, dass Sie dort nicht sonderlich willkommen sind.“
Sie fuhren durch enge Straßen, die von sonderbaren Gebäuden flankiert wurden, die bis in den eisigen Winterhimmel zu ragen schienen. Aus Ziegel gebaut, Stockwerk um Stockwerk hoch. Die Straßen lagen im Schatten und auf den Bürgersteigen herrschte ein Gedränge, wie Eamon es in seinem Leben noch nie gesehen hatte. Jeder hatte es eilig, hatte ein Ziel und kannte kein Zögern. Pferdegespanne in allen Größen drängten sich auf der Straße. Manche mit schlanken, edlen Tieren, die im flotten Trab vorankamen, die meisten aber mit mageren Pferden, deren Glanz in den Augen schon vor langer Zeit erloschen war. Doch auch sie kannten kein Halten, keine Pause. Eamon kam es so vor, als würde er in einen Ameisenhaufen sehen, in den er kurz zuvor getreten war. Alles eilte, hastete und rannte – aber er konnte kein Ziel erkennen.
Die Droschke, in der er saß, wurde geschickt an allem vorbeigelenkt. Die Häuser wurden niedriger, die Hektik ließ nach, sie kamen sogar an einem weitläufigen Park vorbei, an dem hochherrschaftliche Häuser standen – und schließlich hielt die Kutsche vor einem drei- oder vierstöckigen Haus aus roten Backsteinen. Eamon lächelte zufrieden. Ja, so hatte er sich das vorgestellt.
„Hier könnten Sie ein Zimmer bekommen, Sir“, erklärte sein junger Führer und streckte seine Hand aus. „Ich bekomme einen Vierteldollar.“
„Was?“ Eamon schüttelte den Kopf. „Für nicht einmal zwei Stunden Arbeit? Da musst du dir einen anderen suchen, mein Freundchen. Du kannst mich doch nicht ausnehmen, bloß weil ich gerade eben erst angekommen bin.“
Wieder das zahnlückige Lächeln. „Doch. Kann ich, Sir. Wenn Sie nicht einmal nach dem Preis für meine Dienste fragen, bevor Sie sie in Anspruch nehmen, kann ich Ihnen auch nicht helfen.“
„Von wegen.“ Erzürnt erhob Eamon sich. „Gib mir meinen Koffer und dann werde ich dich angemessen entlohnen, mein Junge. Aber ich gestatte dir nicht, mich zu berauben.“
Ein einziger Blick zum Fahrer der Droschke genügte. Der schnalzte mit der Zunge und ließ die lange Peitsche über dem Rücken seines mageren Pferdchens knallen, das eilfertig lostrabte, während der Junge auf die anfahrende Kutsche sprang.
„Diebe! Haltet den Dieb!“, rief er aus voller Kehle, während er versuchte, die Kutsche mit ein paar schnellen Schritten wieder einzuholen. Aber sein Bauch und die mangelnde Bewegung der letzten Tage sorgten dafür, dass er schon nach wenigen Schritten dieses Unterfangen aufgab. Keuchend musste er einsehen, dass er ganz bestimmt kein trabendes Pferd einholen würde. Und ebenso klar wurde ihm, dass auch keiner der Menschen auf der Straße auf seinen lauten Ruf reagierte. Wen interessierte hier schon ein Mann, der mit heftigem irischen Akzent etwas von einem Dieb schrie? Er blickte der flüchtenden Droschke nach. Sein Koffer lag noch immer auf dem Dach, dann verschwand er schwankend im Gewühl der Menschen und Kutschen.
Eamon fasste suchend in seine Tasche. Wenigstens sein Geld war noch bei ihm, auch wenn ihm jetzt die Kleidung und seine Erinnerungen an Irland fehlten. Der Kerzenständer aus seinem Haus, das Bild von seiner geliebten Frau Fionnuala, die leider nicht mehr unter den Lebenden weilte. Die Vergangenheit war Vergangenheit. Er schüttelte den Kopf. Jetzt war nicht die Zeit, um sentimental an den Ramsch aus Connemara zu denken. Er musste sich nun allein auf sein Geld verlassen. Mit seinem Startkapital würde es ihm sicher gelingen, in New York Fuß zu fassen. Jetzt würde er seinen Neustart eben ganz ohne den Ballast der Vergangenheit bewältigen.
Entschlossen drehte er sich zu dem Haus um, auf das der Junge gedeutet hatte. Vielleicht würde er dort ja auch ohne die Hilfe dieses kleinen Diebs eine Unterkunft finden. Er klopfte entschlossen an die erste Tür und setzte sein freundlichstes Lächeln auf. Eine magere Frau mit strähnigen Haaren öffnete die Tür, sah ihn kurz misstrauisch an und knallte ihm dann, ohne ein einziges Wort zu sagen, die Tür vor der Nase zu. Und auch an den nächsten Dutzend Türen erging es Eamon nicht besser – bis er einsehen musste, dass ihn der Junge wahrscheinlich in eine Gegend gebracht hatte, in der er nicht mit einer Unterkunft rechnen konnte. Der verschmähte Neuankömmling spürte, wie der Ärger in ihm aufstieg. Wie sollte er jetzt in dieser fremden und feindlichen Umgebung einen Ort finden, an dem er sich ein wenig ausruhen konnte, bevor er sich ein neues Leben aufbauen konnte? Wo sollte er anfangen? Wo konnte er überhaupt anfangen? Blieben ihm wirklich nur die anderen irischen Immigranten? Doch so schnell gab er nicht auf. Eamon war fest davon überzeugt, dass dieser holprige Start nichts für seine goldene Zukunft zu bedeuten hatte. Er ging einfach immer weiter von Haustüre zu Haustüre und fragte nach einer Unterkunft.
Als er zum hundertsten Male hörte, dass man an einen Paddy ganz bestimmt kein Zimmer vermieten würde, änderte er seine Pläne. Für heute musste er sich wohl oder übel geschlagen geben. Während die Abenddämmerung über Manhattan heraufzog, kaufte er sich bei einem Erdnusshändler ein Tütchen der gerösteten Nüsse und machte sich auf den Weg zurück in den Süden. Dann würde er sich für heute eben irgendwo in der Nähe des Hafens ein Zimmer nehmen und sich morgen nach etwas Besserem umsehen.
Es war schon dunkel im südlichen Manhattan, als Eamon endlich an die Tür einer weiteren Wohnung klopfte. Ein verarmter Einwanderer aus Kerry hatte ihm in dem winzigen Pub um die Ecke erklärt, dass es hier meistens ein oder zwei freie Betten gab. Jeder, der es sich leisten konnte, verschwand allerdings schleunigst wieder und suchte sich eine bessere Bleibe. Und fast jede Bleibe war besser – das hatte sogar der Mann im Pub zugegeben.
Eine Frau mit streng zurückgekämmten Haaren und einer fleckigen Schürze öffnete Eamon und sah ihm misstrauisch entgegen.
„Was willst du?“, fragte sie in einem Tonfall, als hätte er gerade eine böse Beleidigung ausgestoßen. Oder ihr einen unsittlichen Antrag gemacht, was ihm bei dem intensiven Gestank nach Schweiß und fettigem Essen, den sie ausdünstete, sicher nicht in den Sinn gekommen wäre.
„Ich suche eine Bleibe“, erklärte Eamon lächelnd. „Ein Landsmann war so freundlich, mich auf Ihr Haus zu verweisen, da wollte ich nachfragen …“
„Komm mit!“, unterbrach sie ihn unwirsch, drehte sich um und verschwand ohne ein weiteres Wort in der engen dunklen Wohnung.
Eamon folgte ihr und nach wenigen Schritten stieß die Vermieterin die Tür zu einem kleinen, engen Zimmer auf, in dem er drei Betten auszumachen glaubte. Oder waren es vier? Eamon kniff die Augen zusammen und bemühte sich, etwas in dem dunklen Raum vor sich zu erkennen. Lagen in dem einem Bett wirklich zwei Menschen? Aber das schwache Licht, das auf dem Flur brannte, reichte nicht, um dieses Zimmer auch nur annähernd zu erhellen.
Die Frau deutete auf ein Bett direkt neben der Tür. „Halber Dollar die Woche, vorab zu bezahlen. Wenn du duschen willst, kostet das extra.“
„Ein halber Dollar?“ Dafür hätte man in Galway in einem feinen Hotel absteigen können.
„Wenn es dir zu teuer ist, kannste gehen“, erklärte die Frau unbeeindruckt und schloss die Tür wieder.
„Nein, nein.“ Eamon nestelte einen halben Dollar aus seiner Geldbörse und gab ihn ihr. „Ich nehme das Bett.“
„Gut. Ich wünsche nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr gestört zu werden.“ Damit drehte sie sich um und verschwand in einem anderen Zimmer, das sie offensichtlich alleine bewohnte.
Eamon stand nun allein auf dem Flur. Kein Gepäck und nur 57 und einen halben Dollar in der Tasche. Und todmüde. Er schob die Tür zu dem Zimmer wieder auf und setzte sich auf das Bett, das die Vermieterin ihm zugewiesen hatte. Es roch nach Moder und verbrauchter, kalter Luft. Schnell hatten sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt und er sah sich in seinem Quartier für die Nacht um. In dem Bett gegenüber lagen tatsächlich zwei Menschen aneinandergedrängt im Tiefschlaf. Eamon seufzte. Es war ja nur für eine Nacht. Und ein Anfang, immerhin. Und morgen früh würde die Welt sicherlich heller aussehen.
Als er in der Morgendämmerung die Augen aufschlug, musste er erkennen, dass dieses Zimmer noch schlimmer war, als er angenommen hatte. Die Wände waren so feucht, dass die Tapete an einigen Stellen in welligen Streifen herabhing. Der Gestank nach benutzten Nachttöpfen war übermächtig und die anderen Gestalten in dieser Unterkunft sahen erbärmlich aus. Zum Glück schliefen sie noch. Stöhnend setzte sich Eamon auf die Bettkante und rieb sich über das Gesicht. Für einen winzigen Augenblick sehnte er sich nach seinem Haus an der Küste des Atlantiks, in dem die Luft immer frisch war und nach Salzwasser schmeckte. Dann verbot er sich diese Gedanken.
„Neu angekommen?“ Eine Stimme aus dem Bett neben ihm riss ihn aus seinen Gedanken „Willkommen. Ich bin Roddy.“
„Eamon“, antwortete er einsilbig. Er wollte keinen Mann kennenlernen, der in so einem Zimmer hauste.
Aber Roddy ließ sich so leicht nicht abschütteln. Er erhob sich und streckte Eamon seine nicht sehr saubere Hand hin. „Sei gegrüßt. Willst du mit mir kommen und nach einem Frühstück sehen?“
Erst jetzt bemerkte Eamon, dass ihm der Magen knurrte. Gestern hatte er den ganzen Tag nur dieses eine Tütchen Erdnüsse gegessen. Die Aufregung um seinen gestohlenen Koffer und die ernüchternde Suche nach einer Unterkunft hatten ihn ganz vergessen lassen, dass er auch ein ordentliches Essen brauchte.
Also nickte er nur und murmelte: „Essen klingt gut. Weißt du, wo es so etwas gibt?“
„Ein Deli, gleich um die Ecke“, erklärte Roddy eifrig. „Die besten Eier der Stadt, würde ich sagen.“
Die beiden Männer hielten sich nicht lange mit Wäsche oder Körperpflege auf. Sie erhoben sich aus ihren Betten, zogen die Jacken über die Hemden, in denen sie geschlafen hatten, und machten sich auf den Weg.
Das Deli entpuppte sich als kleiner Laden mit nur wenigen Tischen, in dem mehr Irisch als Englisch gesprochen wurde. Aber es roch verheißungsvoll nach gebratenen Eiern und Speck und Eamon ließ sich eine üppige Portion geben. Dazu dick geschnittenes Brot, das erst an diesem Morgen gebacken worden war. Er nahm einen großen Bissen und fühlte sich das erste Mal seit seiner Ankunft in New York wieder wie ein glücklicher Mann.
„Wo kommst du denn her?“, fragte er seinen Begleiter, der ebenfalls sein Frühstück in sich hineinschaufelte.
„Donegal“, erklärte Roddy mit vollem Mund. „Heimat der Steine und der leeren Teller. Ich dachte, hier wird es besser.“ Er zuckte mit den Schultern. „Aber bis jetzt habe ich nur diese elenden Fabriken entdeckt, in denen man schuften muss wie ein Sklave. Da bleibe ich nicht für immer! Was machst du denn so?“
„In Connemara war ich Kaufmann auf einer kleinen Insel. Dann wurde der Verkehr auf dem Meer immer weniger und die Leute blieben aus. Daraufhin habe ich meinen Laden verkauft und bin hierhergekommen. Vielleicht mache ich hier auch einen Laden auf, wer weiß?“ Sorgfältig wischte Eamon das Eigelb mit dem weichen Brot auf und trank einen weiteren Schluck von dem kochend heißen Tee.
„Wirklich?“ Roddy sah ihn bewundernd an. „Hast du denn genug Geld für einen eigenen Laden?“
„Nein“, schüttelte Eamon den Kopf. „Als ich mein Geschäft verkauft habe, war es nicht mehr viel wert. Und mein Haus konnte ich auch nicht mehr verkaufen, weil es ebenfalls nichts mehr wert war. Es lag einfach zu … abgelegen.“ Er musste kurz auflachen. „Ein abgelegenes Häuschen auf einer einsamen Insel. Das gibt es wohl nur in Irland …“
Roddy konnte sich ein Grinsen ebenfalls nicht verkneifen, wurde dann aber schnell wieder ernst. „Wenn du nichts Eigenes aufmachen kannst, wird es schwierig. Die Leute mit den kleinen Stores beschäftigen meistens ihre komplette Familie. Der vertrauen sie. Was ganz schön dämlich ist. Gerade die Familie klaut ja oft genug schlimmer als die Raben.“
Eamon winkte ab. „Ich werde schon jemanden davon überzeugen, dass ich genau der Richtige für ihn bin. Ich habe schließlich Erfahrung. Das sollte doch so einiges zählen.“
„Aber keine Erfahrung in dieser Stadt. Ich fürchte, hier ist es ein bisschen anders, einen Laden zu führen: In einem Dorf kennst du jeden, der über die Schwelle tritt. Du wusstest früher sicher ganz genau, wem du einen Kredit geben konntest und wem nicht. Das ist jetzt nicht mehr so. Du kennst hier niemanden und in New York will dich jeder übers Ohr hauen. Wirklich jeder. Ist so, wirst du schon noch sehen.“
„Keine Sorge, ich finde mich zurecht. Was machst du für dein Geld?“
„Heute?“ Roddy lächelte verlegen. „Ich gehe nachher noch zu einer der Fabriken, die Kleider herstellen. Die brauchen oft einen, der für einen Tag aushilft. Mal sehen.“
„Du hast nichts Festes?“ Eamon war überrascht.
„Selten. Und wenn doch, dann immer nur für ein paar Tage oder auch mal eine Woche. Ist schwer, was zu kriegen, obwohl die Bezahlung nicht einmal gut genug ist, um aus dem Loch, in dem wir wohnen, herauszukommen.“ Roddy griff nach seiner Kappe, die er neben sich auf den Stuhl gelegt hatte. „Ich mache mich jetzt besser auf den Weg, mal sehen, ob sich was ergibt. Willst du mitkommen?“
Eamon schüttelte den Kopf. „Nein. Ich will heute mit den Ladenbesitzern in der Gegend sprechen, ob sie eine Verwendung für meine Dienste habe. Schließlich habe ich wirklich eine Menge Erfahrung, das muss doch auch hier etwas wert sein…“
„Ich drücke dir die Daumen“, murmelte Roddy. „Aber ich habe meine Zweifel. Die irischen Familien halten zusammen wie Pech und Schwefel. Und die anderen wollen keine Iren. Halten uns Katholiken allesamt für papistische Monster. Oder so etwas Ähnliches.“ Mit einem kurzen Kopfnicken verabschiedete sich Roddy und ging.
Kopfschüttelnd blickte Eamon seinem Zimmergenossen nach und machte sich kurz darauf selbst auf den Weg. Wer so wenig an seine Zukunft glaubte wie dieser Roddy, aus dem konnte einfach nichts werden. Da war er sich sicher. Er würde sicherlich nicht so enden.
Eamon verließ das Deli und öffnete mit freundlichem Gesicht die Tür zum ersten Laden, der an der Straße lag, … um sich nur drei Minuten später mitsamt seinem Lächeln wieder auf der Straße zu finden. Keine Stelle frei, nur die Familie, sowieso nicht genug Geld für alle da. Genau davor hatte ihn Roddy gewarnt, doch Eamon beschloss, dass er sich nicht von einer einzigen Absage unterkriegen lassen wollte, und ging direkt in das nächste Geschäft. Ohne Erfolg und mit den gleichen Antworten.
So erging es ihm an diesem Tag überall. Am nächsten ebenfalls. Am dritten Tag verließ Eamon das irische Viertel und musste die noch sehr viel härtere Wahrheit erkennen, dass wirklich niemand in New York auf einen Iren wie ihn gewartet hatte.
Es verging fast eine Woche, bis Eamon Devlin begriff, dass sein modriges Zimmer wohl erst einmal seine Heimat bleiben würde. Doch auch wenn sich seine Pläne etwas verzögerten, Eamon würde sie nicht verwerfen. Er hatte nicht vor, sein neues Leben so schnell aufzugeben, und so machte er sich jeden Tag erneut auf den Weg, um eine Anstellung als Kaufmann zu finden.
Bei einem seiner Streifzüge durch die Straßen entdeckte er Wanamakers, ein Geschäft, in dem es offenbar alles zu kaufen gab, was ein Mensch brauchte, und noch viele Dinge mehr, die er wahrscheinlich niemals benötigen würde. Das war kein kleiner Krämerladen, wie es sie zuhauf im irischen Viertel gab, das war ein wahrer Palast des Konsums. Das hier musste die Zukunft sein, seine Zukunft.
Eamon schlich durch die einzelnen Abteilungen und konnte sich an diesem Reichtum nicht sattsehen. Sein Entschluss stand schnell fest: Er wollte in einem dieser Department Stores arbeiten! Er wollte in einem feinen Anzug im Trockenen stehen, keinen Schweiß vergießen und freundlich den Menschen bei der Auswahl ihres neuen Kleides oder eines Regenschirms behilflich sein. Das – und nicht die knochenbrechende Arbeit in einer Fabrik – musste sein Ziel sein. Immerhin konnte er rechnen, schreiben und er hatte Erfahrung im Verkauf. Außerdem: Mr Wanamaker hatte so viele Angestellte, dass er vielleicht sogar einen Paddy darunter duldete.




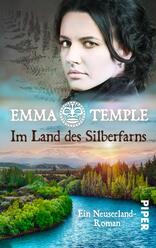





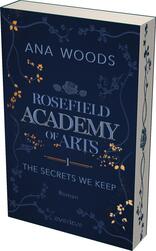




Seit ich 1981 vom "Galway bug" gebissen wurde, bin ich, zunächst im Urlaub, jetzt permanent in Irland. Frau Tempel hat die Essenz Westirlands- nicht Dublins!- voll erfasst, vor allem die der 80er/90er Jahre. Kritik der klischeehaften Übertreibung und der Seichtheit in den Blogs weise ich weit von mir. Solche Kommentare sind vielleicht für einen Peter Baumann typisch, aber nicht für Leute, die Iar Connacht wirklich kennen.
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.