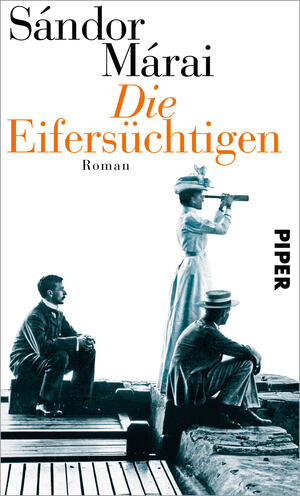
Die Eifersüchtigen
Roman
„in Zeiten weltweiter ›Unordnung‹ zeigt sich die Zeitlosigkeit des Romans und seiner an der Gegenwart scheiternder Gestalten. Und an der stilistischen Großartigkeit des 1989 in San Diego (Kalifornien) gestorbenen Ungarn, der immer wieder tief und seitenlang in das melancholische Innenleben seiner Gestalten eintaucht, gibt es auch fast acht Jahrzente später keinen Zweifel.“ - Wilhelmshavener Zeitung
Die Eifersüchtigen — Inhalt
Der nahende Tod des Vaters bringt sie alle zusammen. Nach langen Jahren fernab der Heimat kehren Peter Garren und seine Geschwister Anna, Tamás, Albert und Edgár in ihr Elternhaus zurück. Dort werden sie konfrontiert mit einem feinmaschigen Netz aus unausgesprochenen Gesetzen, die das bürgerliche Elternhaus seit jeher geprägt haben. Eifersüchtig beäugen sich die Geschwister, alte Streitigkeiten holen sie ein, und über allem liegt die Stimmung nervösen Wartens. Was geschieht, wenn mit dem Ende Patriarchen das einzige verschwunden sein wird, das sie verbunden hat? Bedeutet das den Untergang ihrer Dynastie? – „Die Eifersüchtigen“ gilt als spätes Hauptwerk Sándor Márais, in dem er die Grundaussage seines Werkes zusammenfasst. Atmosphärisch dicht und psychologisch meisterhaft erzählt es vom Verfall einer bürgerlichen Familie.
Leseprobe zu „Die Eifersüchtigen“
Brief, Reise
Der Brief lag zwischen einem Formular und einer Zeitung mitten auf dem Schreibtisch. Es war nach fünf Uhr, als Péter nach Hause kam, die Sonne schien noch. Das Sonnenlicht war böswillig und unbeständig wie immer Anfang April hier in den Bergen, es überzog die Erscheinungen des Frühlings mit einer kalten, theatralischen Beleuchtung: Seit zwei Wochen hatte man ständig das Gefühl, in einem patriotischen Volksstück mitzuspielen. Er ging durch das leere Zimmer, sah sich den Brief von Weitem an, erkannte die Schrift und wusste es, wusste es [...]
Brief, Reise
Der Brief lag zwischen einem Formular und einer Zeitung mitten auf dem Schreibtisch. Es war nach fünf Uhr, als Péter nach Hause kam, die Sonne schien noch. Das Sonnenlicht war böswillig und unbeständig wie immer Anfang April hier in den Bergen, es überzog die Erscheinungen des Frühlings mit einer kalten, theatralischen Beleuchtung: Seit zwei Wochen hatte man ständig das Gefühl, in einem patriotischen Volksstück mitzuspielen. Er ging durch das leere Zimmer, sah sich den Brief von Weitem an, erkannte die Schrift und wusste es, wusste es sofort. Anna benutzte noch immer dieses elfenbeinfarbene Briefpapier und schrieb mit lila Tinte, in bauchigen und zaghaften Buchstaben. Er ging zur Speisezimmertür und rief hinein: „Edit.“ Aber Edit war um diese Zeit mit den Hunden unten am See. Er blieb an der Treppe stehen, lauschte und hörte aus dem Obergeschoss die Schreibmaschine der Baronin pochen. Die Baronin schrieb schnell, beinahe so schnell, wie sie sprach. Plötzlich stockte das Geräusch der Maschine, irgendetwas war oben geschehen, in einem Zimmer, in einem Hirn, die Baronin zögerte, vielleicht fiel ihr ein Wort nicht ein, vielleicht erschrak sie vor ihrer verantwortungslosen Handlung, dem Schreiben, und hielt für einen Moment dennoch inne, wie ein Mörder mitten in der blutigen Tat. Dann setzte das feine, traurige Rattern wieder ein – nein, die Baronin war nicht erschrocken, sie schrieb schon weiter. „Sie schreibt nicht einmal schlecht“, dachte Péter Garren. Die Baronin schrieb so, als erinnerte sie sich dunkel an irgendetwas, als suchte sie die Worte, wollte unbedingt etwas erzählen, aber die Worte waren alle nur ähnlich, sie erinnerten nur an etwas – und das, was sie sagen wollte, war irgendwo verschwunden, verloren gegangen im Leben oder in einer allgemeinen, internationalen Unordnung, vielleicht war es auch von einem geografischen Unglück verschluckt worden und ruhte nun tief unter der Erde, unter Granitschichten, in Bernstein eingeschlossen wie eine urzeitliche Mücke. Diese Mücke wollte die Baronin aus der Unordnung, dem Unglück, unter der Erde hervor-, aus dem Granit und dem Bernstein herausausgraben. Sehr schwierig, dachte Péter voller Anteilnahme. Dann dachte er: Vielleicht sind sie die Echten, die Dilettanten. Manchmal ist sie beinahe groß und erhaben. Für sie ist ein Mensch, der in den Roman hineinkommt, eine Figur von Fleisch und Blut, man muss ihn nur gut „einführen“ und alles über ihn erzählen, dann lacht oder weint die Romanfigur, wie es ihr gerade in den Sinn kommt. Die Baronin ist unerschrocken. Anders kann es auch gar nicht sein. Sie ist es, die glaubt; an die Erinnerungen, an die Romanfiguren und die Zeitgeschichte. An irgendetwas glaubt sie auf jeden Fall. Außerdem leidet sie auch, die Ärmste. Und wie kühl sie schreibt, wie verschämt! Dann dachte er: Edit ist jetzt nicht hier, und ihr Fehlen empfinde ich als natürlich. Edit war niemals da, wenn ich sie wirklich gebraucht habe. Die beiden Vokale ihres Namens, hellblau und weißgrau, sind wie die angeschmutzten Abzeichen eines Ballspielvereins. Und: Wie feige ich bin. Ich muss den Brief lesen. Er ging zum Tisch, öffnete mit kalten, zitternden Fingern den Umschlag, sah den Brief erst zerstreut und routiniert an, packte dann mit gierigem Blick die Sätze und las.
Der Brief war von Péter Garrens ältester Schwester, Anna, der Lehrerin. Lieber Péter, schrieb sie, ich erfülle eine traurige Pflicht. Und: Vater liegt schon den dritten Monat, die Ärzte haben alle Hoffnung aufgegeben. Immer schrieb sie solche Briefe. Als wolle sie sagen: Ich gestatte mir, dir mit untertäniger Ehrerbietung mitzuteilen, dass unser Vater im Sterben liegt. Péter zischte auf. Den Sachverhalt verstand er noch nicht, aber die billige Formulierung schmerzte. Als schickte einem jemand in braunem Packpapier die abgehackte Hand eines geliebten Menschen. So schrieb sie, alle drei Monate seit zwölf Jahren, am letzten Sonntag jedes dritten Monats auf demselben elfenbeinfarbenen Briefpapier und mit lila Tinte: Sehr erfreut erfahren wir aus Deinem lieben Brief, dass Du bei Deiner Arbeit gut vorankommst. Seit zwölf Jahren erfuhr Anna am letzten Sonntag jedes dritten Monats sehr erfreut, dass Péters Arbeit gut vorankam (oder dass er mit seiner Arbeit gut vorankam; denn manchmal verbündeten sich die Wörter gegen sie, revoltierten und verwirrten spöttisch die mechanischen Verbindungen, die sie aus ihnen schuf). Seit zwölf Jahren freute sich Anna, dass Péter und seine Arbeit in einem unbestimmten, verschämt verflochtenen Verhältnis vorankamen, und seit zwölf Jahren vergaß sie konsequent zu fragen, von welcher Natur denn Péters Arbeit sei, ob er Musik komponiere oder mit Sklaven handle oder vielleicht eine Spedition gegründet habe. Die Einzelheiten interessierten sie nicht. In ihren Briefen vermischten sich die Tatsachen sonderbar mit den in geschäftssprachlichen Wendungen ausgedrückten Traumbildern. Es ist mir eine besondere Freude, schrieb sie, und dann beendete sie den Satz: gestern habe ich einen Vogel gesehen. Oder: Mit tiefem Schmerz gebe ich bekannt – aber am Ende des Satzes hatte sie vergessen, was sie mit tiefem Schmerz bekannt geben wollte, und erwähnte für alle Fälle, dass es am Morgen geregnet habe. Sie verwendete die Wörter in ihren Texten wie Requisiten der Industriekultur, wie einen Überschuh oder einen elektrischen Staubsauger. All das brauchte man zum Leben. Auch die fertigen Wörter brauchte man zum Leben: Irgendwo hinter dem Überschuh und mit schwesterlicher Liebe umarmt Dich lebte sie, Anna, die geträumt und gestern einen Vogel gesehen hatte. Es war, als seufzte sie am Anfang jedes Satzes. Anders ging es nicht, Vereinbarungen verpflichten.
So schrieb sie, dass der Vater im Sterben lag. Die hervorragendsten Ärzte der Stadt stehen ratlos am Krankenbett unseres armen, guten Vaters, schrieb sie. Wir rechnen ganz gewiss damit, dass Du nach Eintreffen meines Briefes in den Zug steigst und an Vaters Krankenbett eilst. Edgár kommt auch. Albert hat telegrafiert, dass er mit dem Postschiff kommt. Du weißt, schon mit dem Dreitausendtonner, mit dem Tamás auf die Inseln gefahren ist. Péter erinnerte sich nicht. Er sah ein Schiff vor sich, Tamás steht an Deck, einen weißen Tropenhelm auf dem Kopf, er lügt noch irgendetwas, dann verschwindet er in der großen weiten Welt; Polizei, Gefühle, Gedanken können ihm nicht mehr folgen, man kann nicht wissen, wo er lebt, was er denkt, was er möchte. Er war mit dem Postschiff abgefahren. Wie einfach. Anna hatte jedenfalls mit ihren Gedanken für einen Augenblick bei dem Postschiff und den Inseln verweilt. Dann, als käme sie wieder zur Besinnung, als könne sie die Tatsachen nicht ertragen, die Wohnung, die Krankheit des Vaters, die Sterne, von denen am Sonntagnachmittag im Radio berichtet wurde, die Nierensteine und dass man manchmal durch das Zimmer gehen musste, in dem die Mutter gestorben war, dann begann sie zu schreien. Komm sofort!, schrieb sie brüllend. Und untertänig beendete sie den Brief, als wolle sie das Schicksal und die Wörter um Verzeihung bitten: Wenn Du ihn noch lebend sehen willst.
Der Brief war aufgeregt, voller Zeichensetzungsfehler, überflüssiger Ausrufe- und falscher Fragezeichen. Péter sah sich den Umschlag an: Der Brief war mit der Luftpost geschickt worden. Aus Annas Sicht musste die Luftpost ein Abenteuer sein wie für andere eine Weltumrundung an Bord des neuen Luftschiffs. Er sah Anna vor sich, wie sie auf die Post eilte, ihre gehäkelte Jacke straff zugeknöpft, um sich ja nicht zu erkälten während des Fluges in der großen Kälte! Irgendetwas von Annas Seele ist endlich einmal geflogen!, dachte er und lächelte traurig. Ein paar Worte, mit lila Tinte festgehalten, etwas von Annas Seele, war einmal im Leben hochgeflogen, über Berge und Länder hin. Er sah Anna vor sich, wie sie im Postamt vor dem Gitter stand, wie sie aufgeregt, mit entschuldigendem Lächeln und zitternden Fingern den Brief hinüberreichte – auf dem Kopf den Hut mit den Dohlenfedern – und plötzlich etwas in der Welt in Gang setzte, das Flugzeug startete mit Annas Brief, in der Tiefe regten sich große Berge und Wälder, als würde die Erde von einem Beben erschüttert, und mit entsetzlichem Brausen und Explodieren flog die Nachricht über die Welt, die Nachricht, die Anna losgeschickt hatte, die entsetzliche Nachricht, die die Welt bewegen sollte, die Nachricht davon, dass der Vater sterben würde. Anna nickte und gab dem Schalterbeamten Geld. Jetzt war sie feierlich, ihr Gesicht gerötet.
Péter ging in den Erker und öffnete einen Fensterflügel. Der See hatte sich mit Nebel gefüllt, als hätte er gekocht und dampfte noch. Der Nebel lag in einer dünnen Schicht über dem Wasser; auf Aufnahmen von Seelenbeschwörern breitet sich so der Nebel im Dunkel aus, der Stoff, den das besessene Medium ausstößt, die fixe Idee, die einige kranke und entschlossene Fantasien materialisieren. Vielleicht bäumte sich gerade ein Selbstmörder in der Tiefe des Sees auf; er bereute es, wollte doch lieber leben, und jetzt gab er Zeichen … Oberhalb des Nebels war die Landschaft klar, scharf konturiert, sanft und frisch wie eine mit Wasserfarben kolorierte Prüfungszeichnung. Die Holzhäuser waren mit grüner Farbe gestrichen, die Fensterrahmen mit rotem Öl. Der Wasserfall durchzog wie ausgebreitete Nervenstränge das braune, festfleischige Gewebe des Berges. Ein alter Priester fuhr auf dem Fahrrad am Fenster vorbei, hinter ihm ein junger Gehilfe, auf dem Rücken die Tasche mit den Andachtsgegenständen; wahrscheinlich kamen sie von einem Sterbenden, hatten ihm die letzte Ölung gegeben, während der Sterbende mit glasigen Augen und sittsamem Grauen den Priester an- und in die Dunkelheit hineingesehen hatte. Aus der Landschaft strömte der Tod, als wäre etwas ausgesprochen worden. Péter wusste nichts über den Tod. Um die Toten gab es nach Aas riechende Blumen, große Ausgaben und Streit. Er verstand den Tod nicht. „Für etwas“ sterben, sagte man; Péter schüttelte den Kopf. Man stirbt nicht für etwas. Der Tod schien manchmal ganz von Nahem auf, ausgezehrte Münder, Bärte und Zähne; er war schauderhaft und unwirklich, aber alles in allem so irdisch, so menschlich, etwas kindisch: Man konnte sich vor ihm schützen. Dann war da der andere Tod, vor dem man sich nicht schützen konnte, der Tod, der in uns sitzt, unser Tod; wenn eine Form zu reifen beginnt und nicht mehr hält, wenn eine schreckliche Hilflosigkeit den Takt des Lebens und der Arbeit lähmt und das schlechte Gewissen plötzlich losbrüllt, dass wir der Tod sind, dass wir ihn erfunden haben und verbreiten. Einmal, vor sehr langer Zeit, vielleicht vor zwanzig Jahren, hatte sich ein Junge im gelben Frack erschossen; unten in der Gaststätte spielte Musik, sie hatten an dem Tag ihr Abitur abgelegt, niemand ahnte etwas. Der Junge hieß Géza. Oder Ervin? Ernő? Er erinnerte sich nicht.
Die Nachricht flog durch die Luft, und die Welt füllte sich mit ihr. Die Tiere im Wald witterten und sahen zum Himmel auf. Der Traum ist zu Ende, dachte Péter. Jetzt wird man etwas anderes träumen müssen. Den Vater sah er in diesem Augenblick nicht. Die Krankheit, das Sterben, diese neue, unbekannte Lebensform, verbargen den Vater so tief, als wäre er verreist, als lebte er jetzt in ungewohnter Umgebung, gefiele sich in eigenartigen, neuen Sitten, stünde in weißem Kleid in der Mitte der Plantage, inmitten seiner Sklaven, oder hätte vielleicht Uniform angezogen und kommandierte laut mitten auf einem Kasernenhof. Mit dem Vater war etwas geschehen, das man mit dem Verstand nicht begreifen konnte. Vielleicht hätte man es mit Musik ausdrücken können oder lautlos, wie wenn eine Jahreszeit vergeht und ihre Requisiten der nächsten übergibt. Er fühlte keinerlei Schmerz. An seiner Hand spürte er Las Parfum; vor einigen Minuten, vor schrecklich langer Zeit, hatte er in Las Zimmer auf dem Sofa gelegen, gegenüber dem Fenster, durch die Spalten der locker hinuntergelassenen Jalousie lösten sich das Licht und die auf der Straße vorüberkommenden Gegenstände und Gestalten in die Bestandteile von Zeit und Materie auf, man konnte nur einen sekundenlangen Regenschirm sehen, einen momentlangen Hut, die zwischen zwei geometrischen Punkten vorbeizogen. Im Zimmer war es still, La badete. Diese halben Stunden mochte er, sie waren die reinsten und traurigsten in seinem Leben. Die Bewegungen und Klänge der Liebe lebten und wirkten noch irgendwo im Zimmer, wie Worte oder wie der Duft eines Menschen, aber ihn ging dies nichts mehr an, etwas ließ ihn schwimmen und trug ihn weiter, weg von La, vielleicht zu Edit, zwischen zwei Ufern, mit dieser schwebenden, schwerelosen Verantwortungslosigkeit. Das Erlebnis gab jetzt seine letzte Kraft ab, irgendetwas hatte ihn hergebracht, und etwas trug ihn nun von hier fort, langsam, gleichgültig und gnadenlos. Später hatte La ihn um Geld gebeten.
Er machte sich auf den Weg, um zu ihr zurückzugehen. Gegen sieben konnte er bei ihr sein; La würde sagen „Oh!“ und „Mein armes kleines Hündchen!“ und „Möchtest du einen Tee?“ Oder etwas Ähnliches. La würde genau das sagen, was gesagt werden musste, und im selben Augenblick würde der Inhalt des Briefes konkret werden, Tatsachen würden ihn umgeben, Gepäckstücke, Erinnerungen, Schmerzen, man würde sich um die Fahrkarte kümmern müssen, sich das kranke Gesicht des Vaters vorstellen, eine Arznei gegen die Seekrankheit besorgen, schwarze Handschuhe und eine schwarze Krawatte. La würde sagen: „Reg dich nicht auf, die Ärzte machen heute schon vieles möglich.“ Aber gewiss würde sie zum Abschied auch sagen: „Gott weiß, vielleicht ist es ja besser für den Ärmsten.“ Er roch an seiner Hand, sog von der Handfläche tief Las billiges und dreistes Parfum ein wie ein Kokainsüchtiger das Rauschgift. Er konnte nicht ohne sie sein. Dann trug ihn die Welle wieder fort von ihr, diese tiefe und gnadenlose Welle, zurück zu Edit, die ihre Hand an die Stirn legen würde, zum Fenster gehen, Péters Schulter mit den Fingerspitzen berühren und ganz leise sagen: „Der Ärmste, der Ärmste.“ Mehr würde sie nicht sagen. Sie würde ihm beim Packen helfen. Sollte er jetzt schon einen schwarzen Anzug mitnehmen? War es nicht Mord, wenn man zu einem Menschen in Gefahr heimlich einen schwarzen Anzug mitnahm? So töten wir einander. Vielleicht würde es helfen, wenn er Sommerkleidung mitnähme, einen weißen Smoking, wie man ihn in südlichen Gegenden trägt, einen Schläger und Detektivromane. Jetzt gab man dem Vater Arznei, Anna stand am Kopfende des Bettes und maß sorgsam die Tropfen ab. Er lebte noch, Péter wusste sicher, dass er lebte, er sah seine aderndurchzogenen, sehr weißen Hände, diese weibischen und unbarmherzigen Hände, die der Vater nach dem Mittag und Abendessen zum Kuss reichte wie der Oberpriester einer unverständlichen Religion. Péter hatte einmal geweint und war vor ihm niedergekniet; er hatte die Knie des Vaters umarmt und durch die Tränen zu ihm aufgesehen, aber von hier unten sah er nur die Weste und die Uhrkette, des Vaters Kopf verlor sich in der Höhe, in seiner schauderhaften, materiellen Bedeutsamkeit, in einer Art feinem Nebel. Diese Veränderung lenkte ihn ab und überraschte ihn; trotzig kniete er, aber er vergaß zu weinen. Der Vater ließ zu, dass Péter vor ihm kniete, mit der Hand berührte er zaghaft die Locken des Jungen und murmelte fremde Wörter. Niemals erfuhr er, ob der Vater ihm damals die Absolution erteilt hatte.
Er hatte das Gefühl, er müsse sich beeilen, und sah auf die Uhr. Gleich würde die Baronin herunterkommen, im blutroten Frisiermantel, sie würde mitten auf der Treppe stehen bleiben und sagen: „Mein Teuerster, welch ein Schlag! Wie sehr ich Sie bedauere! Was heißt Traubenzucker auf Englisch?“ Er musste sich beeilen, denn er wollte zu La gehen, doch am Abend würden Gäste kommen, Emmánuel und die beiden Musiker. Mit Edit würde er noch etwas besprechen müssen, er musste nach Hause fahren, zum Vater, musste zusehen, wie er starb, den schwarzen Anzug anziehen, den er jeden Morgen im Schrank argwöhnisch betrachtet hatte – einmal werde ich ihn anziehen müssen, zu Vaters Beerdigung, hatte er jeden Morgen gedacht. So beginnt ein Tod. Den schwarzen Anzug hatte er bislang nur zu abendlichen Empfängen getragen, einmal war er in die Botschaft gegangen, einmal ins große Hotel, als ein Verwandter aus Sumatra auf der Durchreise gewesen war. Er hatte den Anzug benutzt wie ein spitzes und scharfes Messer: Man verwendet es, um Brot zu schneiden, aber im Geheimen weiß man, dass man mit ihm auch töten kann. Er musste sich beeilen; plötzlich hatte er das Gefühl, man hätte in der Ferne das Uhrwerk einer Höllenmaschine aufgezogen. Nun würde der Vater beerdigt werden, er würde seine Geschwister treffen und dann hierher zurückkehren, in dieses Zimmer, zwischen den Tiroler Schank und den Bauerntisch, und etwas würde beginnen, das man nicht mehr hinausschieben konnte. Etwas Persönliches würde beginnen. Péter Garren war sechsunddreißig Jahre alt. Der Vater lag im Sterben.
Im Zimmer breitete sich die Dämmerung aus, und Blumen standen auf dem Tisch, in einem Weckglas, gelbe Akazien und Kaiserkronen in Rot und Grün. Vor dem Sofa lagen Edits Pantoffeln, auf dem Sofa die Karten, die sie vor dem Einschlafen immer befragte. Das Zimmer war geräumig und schwebte über dem See, sein einziges, riesiges Fenster blickte dem Berg und dem Wald ins Auge wie ein vornehmer Herr mit Monokel einer Menschenmenge. Das Zimmer hatte etwas Freches und Uneingerichtetes an sich. Immer hatte Péter das Gefühl, gleich würde jemand klingeln und etwas hereinbringen, eine Lampe oder einen Stuhl, und dann wäre die Einrichtung des Zimmers vollkommen, man konnte sich beruhigen, endlich das Gefühl haben, zu Hause zu sein. Aber genau diese Lampe oder dieser Lehnstuhl wurde niemals gebracht. Vielleicht, weil es so ein Möbel auf der Welt nicht gab. Die Karten hatte Edit auf der Messe gekauft und schon zerknickt, die wichtigeren mit Eselsohren gekennzeichnet, der Braut mit rotem Buntstift einen Schnurrbart gemalt. Péter suchte den „Brief“, die „Reise“ und den „Tod“. Der Brief sah ganz so aus wie ein offizieller und normaler Brief, mit rotem Siegel, die Reise zeigte einen jungen Mann im grünen Gehrock, wie er traurig einer Postkutsche hinterhersah, und der Tod lag im Sarg, ganz klein, in einem Kindersarg, beladen mit Kreuzen und Lilien. Er warf den Brief auf die Karten und ging zu La.
„in Zeiten weltweiter ›Unordnung‹ zeigt sich die Zeitlosigkeit des Romans und seiner an der Gegenwart scheiternder Gestalten. Und an der stilistischen Großartigkeit des 1989 in San Diego (Kalifornien) gestorbenen Ungarn, der immer wieder tief und seitenlang in das melancholische Innenleben seiner Gestalten eintaucht, gibt es auch fast acht Jahrzente später keinen Zweifel.“
„ein verzweifeltes Trostbuch mitten hinein in den seismografisch wahrgenommenen Beginn einer allgemeinen internationalen Unordnung, ein pathetisch aufgeladener Abgesang, der wort- und bildmächtig den Zerfall einer Familie beschreibt.“
„Einer der Höhepunkte der großen ungarischen Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts“
„Das große Vorbei ist Márais zentrales Thema, das er immer neu grandios variierte.“
„Eine intelligente und vergnügliche Lektüre.“
„Sándor Márais literarisches Werk atmet Leidenschaft im Wortsinn“
„Sándor Márais Stil hat eine Eleganz, die wir mit vergangenen Zeiten verbinden. Aber diese Zeiten haben keinen Staub angesetzt – es ist die Eleganz eines großen Autors.“
„Sándor Márais moderner Klassiker der Weltliteratur erzählt psychologisch virtuos vom Verfall einer ungarischen Familiendynastie.“






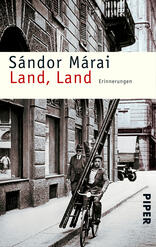
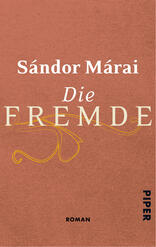

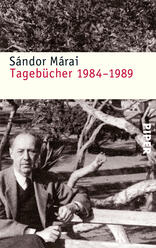




Nach "Die Glut" mein 2. Márai Roman. Die seeeeeeeehr langatmigen Ausführungen haben mich gelegentlich langweilt. Als Aussiedler aus Rumänien (Rumänen sind "die Fremden") habe ich trotzdem lange gebraucht, um herauszufinden, wann und wo die Handlung angesiedelt werden muss. Viele Aussagen treffen auf die Stadt Alba Julia zu, die Zeit ist der Übergang von Ungarn zu Rumänien nach 1918. Sanfter Stil, feine, im Vergleich zur rumänischen, Lebensweise, ja Kultur.
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.