

Der Schmerz der Engel
Roman
„Stefánsson gelingt es, Worte für das Unbeschreibliche zu finden. (…) Die lyrisch unterfütterte Sprache ist es, die dieses Buch so eindrucksvoll macht.“ - Stuttgarter Zeitung
Der Schmerz der Engel — Inhalt
Nordwind, und alles ist weiß, die Posttaschen wiegen schwer auf ihren Schultern. Helga hat ihnen ordentlich Proviant mitgegeben. Du trägst die Verantwortung für ihn, hat sie zu Jens gesagt. Und dann sind die beiden aufgebrochen, zu ihrer gefährlichen Reise durch den isländischen Winter. Was suchen sie da draußen, außer dem Tod?
Leseprobe zu „Der Schmerz der Engel“
Unsere Augen sind wie Regentropfen
Jetzt wäre es schön, zu schlafen, bis sich die Träume in Himmel verwandeln, in einen stillen Himmel ohne Wind, einzelne Engelsfedern schweben herab, sonst nichts, bis auf die Seligkeit dessen, der nichts weiß von sich selbst. Doch der Schlaf flieht die Toten. Wenn wir die starrenden Augen schließen, stellen sich Erinnerungen ein, kein Schlaf. Erst kommen sie vereinzelt, sind sogar schön wie Silber, dann werden sie rasch zu dunklem, alles erstickendem Schneefall, und so ist es seit mehr als siebzig Jahren. Die Zeit [...]
Unsere Augen sind wie Regentropfen
Jetzt wäre es schön, zu schlafen, bis sich die Träume in Himmel verwandeln, in einen stillen Himmel ohne Wind, einzelne Engelsfedern schweben herab, sonst nichts, bis auf die Seligkeit dessen, der nichts weiß von sich selbst. Doch der Schlaf flieht die Toten. Wenn wir die starrenden Augen schließen, stellen sich Erinnerungen ein, kein Schlaf. Erst kommen sie vereinzelt, sind sogar schön wie Silber, dann werden sie rasch zu dunklem, alles erstickendem Schneefall, und so ist es seit mehr als siebzig Jahren. Die Zeit vergeht, die Leute sterben, der Leichnam sinkt in die Erde, mehr wissen wir nicht. Vom Himmel ist hier wenig zu sehen, die Berge nehmen ihn uns, und das Wetter, das diese Berge heftig aufladen, ist dunkel wie das Ende; doch wenn sich nach einem Sturm ein Ausschnitt des Himmels zeigt, meinen wir weiße Streifen von den Engeln zu sehen, weit oben über den Wolken und Bergen, über den Fehlern und Liebkosungen der Menschen, weiße Streifen wie die Verheißung eines großen Glücks. Diese Aussicht erfüllt uns mit kindlicher Freude, und eine längst vergessene Zuversicht regt sich wieder, die unsere Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit nur noch tiefer macht. So ist das, helles Licht macht tiefe Schatten, großem Glück entspricht ein ebenso großes Unglück. Das Leben ist einfach, der Mensch ist es nicht. Was wir die Rätsel des Lebens nennen, ist unser eigenes Durcheinander, sind unsere eigenen dunklen Abgründe. Die Antworten hält der Tod bereit, der uns die Einsicht in ein uraltes Wissen öffnet. Das ist natürlich Unsinn. Was wir wissen, was wir gelernt haben, ist nicht dem Tod entwachsen, sondern aus Gedichten, aus Verzweiflung und den Erinnerungen daran, was Glück bedeutet. Wir verfügen über kein tiefes Wissen, aber was in uns bebt und zittert tritt an seine Stelle und ist vielleicht besser. Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt, weiter als irgendjemand zuvor, unsere Augen sind wie Regentropfen, voller Himmel, klarer Luft und Nichts. Du kannst uns gefahrlos zuhören. Aber wenn du vergisst, dein Leben zu leben, endest du wie wir, eine flüchtig umhergetriebene Herde zwischen Leben und Tod. So tot, so kalt, so tot. Doch irgendwo tief in den Gefilden des Denkens, dieses Bewusstseins, das den Menschen so groß und zum Teufel macht, flackert noch ein verborgenes Licht und will nicht verlöschen, es weigert sich, der erdrückenden Dunkelheit nachzugeben, dem erstickenden Tod. Dieses Licht nährt uns und quält uns, es bringt uns dazu, weiterzumachen, anstatt uns einfach nur wie Tiere ohne Sprache hinzulegen und auf das zu warten, was vielleicht niemals kommen wird. Das Licht flackert, und wir machen also weiter. Unsere Bewegungen sind unsicher, zögernd, aber das Ziel ist klar: die Welt zu retten. Dich und uns zu retten mit diesen Geschichten, diesen Splittern aus Gedichten und Träumen, die vor langer Zeit ins Vergessen gefallen sind. Wir sitzen in einem morschen Ruderboot mit einem brüchigen Netz und wollen Sterne fischen.
Manche Wörter sind Muscheln in der Zeit, vielleicht liegt in ihnen die Erinnerung an dich
I
Irgendwo in Frost und treibendem Schneefall hat es zu dämmern begonnen, und die Dunkelheit des April drängt zwischen den Schneeflocken näher, die sich auf den Mann und seine beiden Pferde setzen. Alles ist weiß von Reif und Schnee, dabei steht doch der Frühling vor der Tür. Sie kämpfen gegen den Nordwind an, der stärker ist als alles in diesem Land, der Mann sitzt vorgebeugt auf dem einen Pferd, hält den Führzügel des anderen fest in der Hand, sie sind längst von Weiß und Eisklumpen überkrustet und werden wahrscheinlich bald selbst zu Schnee: Der Nordwind will sie noch einkassieren, bevor der Frühling kommt. Die Pferde waten durch den weichen Schnee, das hintere trägt eine unförmige Last auf dem Rücken, einen Koffer oder Stapel von Trockenfisch oder zwei Leichen, und die Dunkelheit wird dichter, aber nicht vollständig finster, es ist doch April, und zäh stapfen die Pferde weiter mit der bewundernswerten oder abgestumpften Sturheit, die kennzeichnend ist für alle Wesen, die am äußersten Rand der bewohnbaren Welt leben. Ewig lockt die Versuchung, dass man aufgibt, viele tun’s auch und lassen sich vom Alltag einschneien, bis sie festsitzen, kein Abenteuer mehr vor ihnen, bloß stehen bleiben und sich vom Schnee zudecken lassen, in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder aufklart und der heitere Himmel kehrt zurück. Aber die Pferde und der Reiter leisten noch Widerstand, sie ziehen weiter, obwohl es in der ganzen weiten Welt nichts zu geben scheint als dieses Wetter, alles andere ist verschwunden, der Schneefall löscht die Himmelsrichtungen aus, die Landschaft, und doch stecken Gebirge in diesem Schneetreiben, dieselben Gebirge, die uns einen großen Teil des Himmels vorenthalten, sogar an den schönsten Tagen, wenn alles blau und heiter ist, wenn es Blumen, Vögel und sogar Sonnenschein gibt. Die drei heben nicht einmal die Köpfe, als ihnen aus dem wüsten Schneesturm plötzlich ein Hausgiebel entgegenkommt. Bald taucht ein zweiter auf. Dann ein dritter, ein vierter. Sie aber staksen weiter voran, als ob kein Leben, nichts Wärmendes sie mehr etwas anginge und nichts mehr eine Rolle spielte, bis auf diese maschinenhafte Bewegung. Selbst Lichter glimmen jetzt zwischen den Schneekörnern, und Lichter sind Botschaften, die das Leben schickt. Das Dreigespann hat ein großes Haus erreicht, das Reitpferd geht bis unmittelbar zur Treppe vor, hebt den rechten Huf und scharrt auf der untersten Stufe, der Mann brummt etwas, das Pferd hört auf, dann warten sie. Das vordere Pferd aufgerichtet, mit aufgestellten Ohren, das hintere lässt, wie in tiefe Gedanken versunken, den Kopf hängen. Pferde denken viel nach und stehen von allen Tieren den Philosophen am nächsten.
Endlich öffnet sich die Tür, und jemand tritt hinaus auf den Treppenabsatz, die Augen sofort zusammengekniffen gegen den anfliegenden Schnee, mit hochgezogenen Schultern gegen die Eiseskälte des Windes. Das Wetter beherrscht hier alles, es knetet unser Leben wie Lehm. Wer ist da?, fragt die Person laut und späht nach unten, wirbelnde Flocken zerstückeln die Sicht, aber weder der Reiter noch die Pferde antworten, sie erwidern bloß den Blick und warten; das hintere mit der unförmigen Bürde. Der Mensch auf dem Absatz schließt von außen die Tür, tastet sich die Treppenstufen hinab, bleibt auf halber Höhe stehen, schiebt das Kinn vor, um besser zu sehen, und da endlich gibt der Reiter einen heiseren und röchelnden Laut von sich, als müsse er erst einmal Eisbrocken und Dreck von der Sprache kratzen. Er öffnet den Mund und fragt: Wer zum Teufel bist du denn?
Der Junge zuckt zurück, schiebt sich eine Stufe höher. Das weiß ich auch nicht, antwortet er mit der offenherzigen Aufrichtigkeit, die ihm noch nicht abhandengekommen ist und die ihn zum Einfaltspinsel und Weisen zugleich macht. Niemand Besonderer, nehme ich an.
Wer ist da draußen?, fragt Kolbeinn, der alte Kapitän. Er sitzt über seiner leeren Kaffeetasse und wendet seine nutzlosen Seelenspiegel dem Jungen zu, der wieder hereingekommen ist und am liebsten gar nichts sagen möchte, dann aber doch herausplatzt: Jens der Landbriefträger auf einem Eispferd, er will mit Helga reden. Damit stürzt er am Kapitän vorbei, der in seiner ewigen Dunkelheit zurückbleibt.
Der Junge nimmt schnell die Treppe, läuft den Flur entlang und springt in drei Sätzen die Stufen zum Dachgeschoss hinauf. Er vergisst alles um sich herum, kommt wie ein Geist durch die Öffnung geschossen und bleibt dann hechelnd und wie angewurzelt stehen, während sich seine Augen an den Helligkeitsunterschied gewöhnen. Es ist fast dunkel hier oben, eine kleine Petroleumlampe steht auf dem Fußboden, und vor dem mit Schnee und Abend beladenen Fenster zeichnet sich eine Badewanne ab, Schatten zucken über die Wände, ihm ist, als wäre er in einem Traum gelandet. Er sieht Geirþrúðurs rabenschwarzes Haar, weiße Schultern, hohe Wangenknochen, zur Hälfte ihre Brüste und Wassertropfen auf ihrer Haut. Neben der Wanne erkennt er Helga, eine Hand in die Hüfte gestemmt, eine einzelne Strähne hat sich gelöst und fällt ihr schräg über die Stirn. Er hat sie noch nie so nachlässig gesehen. Der Junge schüttelt kurz und schnell den Kopf, als wolle er sich selbst wachrütteln, dreht sich dann rasch um und schaut in eine andere Richtung, obwohl es da nichts weiter zu sehen gibt als Leere und Dunkelheit, und dorthin sollte ein lebendiges Auge niemals blicken.
Jens der Postbote, sagt er und bemüht sich, sein Herzklopfen nicht in der Stimme hören zu lassen, aber das ist natürlich völlig zwecklos. Jens der Postbote ist da, und er möchte Helga sprechen.
Du darfst dich ruhig wieder umdrehen, oder bin ich so hässlich?, fragt Geirþrúður.
Hör auf, den Jungen zu quälen, sagt Helga.
Was schadet es, wenn er eine alte Frau nackt sieht, gibt Geirþrúður zurück, und der Junge hört, wie sie sich aus der Wanne erhebt.
Menschen nehmen ein Bad, denken über etwas nach, waschen sich und stehen dann aus der Wanne auf – das alles ist ganz normal und alltäglich, aber selbst das Alltäglichste auf dieser Welt kann Gefahren bergen.
Du kannst dich jetzt umdrehen, sagt Helga.
Geirþrúður hat sich in ein großes Handtuch gewickelt, doch ihre Schultern sind noch immer nackt und ihre dezemberschwarzen Haare nass und wirr und vielleicht schwärzer als je zuvor.
Der Himmel ist alt, nicht du, sagt der Junge, und da lacht Geirþrúður leise ein dunkles Lachen und sagt: Junge, du wirst einmal gefährlich, wenn du die Unschuld verlierst.
Kolbeinn knurrt, als er Helga und den Jungen kommen hört. Er verzieht das Gesicht, das sowieso schon überall von den Falten und Schründen durchzogen ist, die das Leben schlägt, seine rechte Hand fährt langsam über den Tisch, tastet wie ein kurzsichtiger Hund, stößt an die leere Kaffeetasse und streicht dann über ein Buch, wobei sich sein Gesicht entspannt, denn Literatur schüchtert uns nicht ein, sondern verleiht uns Konzentration, so ist ihr Wesen, und darum kann sie eine wichtige Kraft sein. Kolbeinns Gesichtsausdruck verhärtet sich wieder, als Helga und der Junge den Gastraum betreten, aber die Hand lässt er auf dem Buch. Othello in der Übersetzung von Matthías Jochumsson. „Haltet ein, zu beyden Seiten; wenn es hier meine Scene zum Fechten wäre, so würd’ ich’s ohne einen Einsager gewusst haben.“ Helga hat einen dicken, blauen Schal umgelegt und geht mit dem Jungen an Kolbeinn vorbei, der sich für gar nichts zu interessieren scheint, dann stehen sie vor der Tür. Helga blickt auf Jens und die Pferde hinab. Die drei sind fast nicht zu erkennen, so weiß und voller Eis sind sie.
Warum kommst du nicht ins Haus, Mann?, fragt sie ein wenig spitz.
Jens blickt zu ihr auf und sagt entschuldigend: Offen gestanden, ich bin am Pferd festgefroren.
Jens wägt Worte stets sorgsam ab, und wenn er von einem langen und beschwerlichen Postritt mitten im Winter zurückkommt, ist er noch schweigsamer als sonst. Was soll man auch mitten in einem Schneesturm, in dem man die Hand vor Augen nicht sieht, oder auf einer rundum von Gipfeln umstandenen kalten und windigen Hochheide mit Worten anfangen? Wenn er sagt, er sei am Pferd festgefroren, dann meint er das wörtlich, dann sind seine Worte glasklar und halten mit ihrer Bedeutung nicht hinterm Berg, wie es sich für Wörter gehört. Ich bin am Pferd festgefroren. Das bedeutet: Der letzte große Flusslauf, den er vor etwa drei Stunden durchqueren musste, versteckte seine tiefen Stellen im schlechten Wetter, und obwohl das Pferd groß ist, geriet Jens bis über die Knie in tiefes Wasser, der Aprilfrost biss binnen kürzester Zeit zu, Pferd und Reiter froren so fest zusammen, dass Jens sich kaum rühren und nicht absitzen konnte, sondern das Pferd auf der untersten Stufe scharren lassen musste, damit jemand auf sie aufmerksam wurde.
Helga und der Junge müssen ordentlich Kraft aufwenden, um Jens vom Pferd zu zerren und ihn dann stützend die Treppe hinaufzubugsieren, was keine leichte Aufgabe ist, denn der Mann ist groß und an die hundert Kilo schwer. Als sie ihn endlich vom Pferd herunter haben, ist Helgas Schal vom Schnee schon weiß, dabei haben sie die Treppe noch vor sich. Jens schnaubt gereizt, die Kälte hat ihn alle Kraft gekostet und zu einem hilflosen alten Mann gemacht. Langsam schieben sie sich die Treppe hinauf. Helga hat in der Gastwirtschaft einmal einen ausgewachsenen Matrosen, mittelgroß und mittelstark, zu Boden gerungen und anschließend wie einen Sack Lumpen vor die Tür geworfen. Unwillkürlich stützt sich Jens mit dem Großteil seines Gewichts auf sie, wer ist auch schon dieser Knabe, viel scheint nicht in ihm zu stecken, der würde ja unter den Schneeflocken zusammenbrechen, geschweige denn unter einem massigen Arm.
Die Pferde, stößt Jens auf der fünften Stufe hervor.
Ja, ja, sagt Helga nur.
Ich war am Pferd festgefroren und kann nicht allein gehen, sagt Jens zu Kolbeinn, während Helga und der Junge ihn halb an ihm vorbeiziehen und halb tragen.
Nimm dem Pferd die Kisten ab, sagt Helga zu dem Jungen, von hier ab komme ich mit Jens allein zurecht. Bring die Pferde dann zu Jóhann, den Weg solltest du finden, und sag anschließend Skúli Bescheid, dass Jens eingetroffen ist.
Kommt der da mit den Pferden und den Packkisten klar?, fragt Jens und mustert den Jungen abschätzig.
In dem steckt mehr, als man ihm ansieht, meint Helga bloß, und der Junge schleppt die Kisten ins Haus, zieht sich etwas über und verschwindet mit zwei erschöpften Pferden in der zunehmenden Dunkelheit und dem sich weiter verschlechternden Wetter.
II
Als der Junge mit Zeitungsredakteur Skúli zurückkehrt, steckt Jens in trockenen Sachen, hat wieder Gefühl und Wärme in den Beinen, eine Riesenportion Quark und geräuchertes Lammfleisch in sich hineingeschaufelt und vier Becher Kaffee getrunken. Die Pferde sind bei Geirþrúðurs Buchhalter Jóhann untergestellt, der allein lebt und immer nur allein ist, was verständlich ist, denn die Menschen tendieren dazu, einen zu enttäuschen. Skúli ist lang und schmal, erinnert oft an eine gespannte Saite. Eine Tasse Kaffee nimmt er dankend an, Bier weist er mit einem Kopfschütteln zurück. Er nimmt Jens gegenüber Platz und legt sich Schreibzeug zurecht, die langen Finger voller Ungeduld. Kolbeinn streichelt Othello, als wäre er mit den Gedanken ganz woanders, er wartet darauf, dass Skúli Jens endlich ausquetscht, dann werden sie die Neuigkeiten zu hören bekommen, die der Redakteur in der nächsten Ausgabe des wöchentlich erscheinenden Volkeswillen drucken wird. Vier dicht bedruckte Seiten über Fisch, Wetter, Tod, Lepra, Graswuchs und Kanonen im Ausland. Schadet nicht, unser tägliches Einerlei mit Neuigkeiten aus der Welt aufzufrischen, es haben lange ungünstige Winde geherrscht, dafür dass es April ist, sind außergewöhnlich wenige Schiffe hier eingelaufen, wir sind nach einem langen Winter ganz versessen auf Neuigkeiten. Jens ist zwar kein Schiff, das von der Sonne ferner Länder beschienen wurde, aber er ist der Faden, der uns in den langen Wintermonaten mit der Außenwelt verbindet, wenn uns nur die Sterne Gesellschaft leisten, die Finsternis zwischen den Sternen und der helle Mond. Drei- bis viermal im Jahr holt Jens die Post aus dem fernen Reykjavík, wo er sie vom Landpostboten aus dem Südland übernimmt. Die übrige Zeit lebt er südlich von hier in den Tälern in einem kleinen Häuschen zwischen lieblichen Bergen und sommergrünen Wiesen und Bauernhöfen, zusammen mit seinem Vater und einer Schwester, die mit so viel hellem Himmel im Kopf zur Welt kam, dass darin nur noch wenig Platz für Gedanken blieb, allerdings auch für Sünden nicht. Die Postroute von Jens ist sicher die schwierigste im ganzen Land. In den letzten vierzig Jahren hat sie zwei Überlandbriefträgern das Leben gekostet, Valdimar und Páll, Unwetter überfielen sie im Abstand von fünfzehn Jahren jeweils im Januar auf einer der Hochebenen. Valdimar wurde rasch gefunden, nicht weit von einer kurz zuvor erbauten Notunterkunft, tiefgefroren. Páll fand man erst im darauffolgenden Frühjahr, nachdem der Schnee größtenteils geschmolzen war. Die Post selbst, Briefe und Zeitungen, lagen glücklicherweise unbeschädigt in den massiven, innen mit Segeltuch ausgeschlagenen Kisten und Taschen, die beide noch über den toten Schultern trugen. Valdimars Pferde fand man noch lebendig, aber von der Eiseskälte so mitgenommen, dass man sie an Ort und Stelle getötet hat. Sein Leichnam war größtenteils unversehrt, doch über die toten Körper von Páll und seinen Pferden hatten sich Raben und Füchse hergemacht.
Der Südlandbote teilt Jens die Nachrichten mit, die er in Reykjavík in Erfahrung gebracht hat. Jens bringt sie uns zusammen mit denen, die er unterwegs noch aufschnappt: Der und der ist gestorben, da hat eine ein uneheliches Kind in die Welt gesetzt, Gröndal hat sich besoffen am Strand herumgewälzt, im Südland war das Wetter wechselhaft und unbeständig, im Hornafjörður im Südosten ist ein dreißig Ellen langer Wal an Land getrieben, die Einkaufsgenossenschaft im Fljótsdal setzt sich dafür ein, dass man auf dem Lagarfljót ein Dampfboot verkehren lässt, man hat so ein Dampfboot in Newcastle bestellt. Das liegt in England, erklärt Jens.
Als ob ich das nicht wüsste, zischt Skúli zurück, ohne aufzublicken. Er fragt und schreibt so schnell, dass die Blätter fast zu rauchen anfangen. Der Junge beobachtet genau, wie sich der Redakteur verhält, wie er fragt. Er versucht sogar über dessen Schulter zu vergleichen, ob zwischen dem, was der Postbote erzählt, und dem, was auf dem Papier landet, große Unterschiede bestehen. Skúli ist so konzentriert bei der Sache, dass er den Jungen kaum beachtet, zweimal nur guckt er ärgerlich auf, als er ihm zu nah auf die Pelle rückt. Die Zeit drängt. Jens ist inzwischen gesättigt, hat seinen massigen Körper mit Skyr, Räucherlamm, englischen Biskuits und Kaffee gefüllt, heiß wie der Himmel und schwarz wie die Hölle, Helga serviert ihm das erste Bier und den ersten Schnaps. Der Alkohol aber verändert unsere Vorstellungen von dem, was wichtig ist. Vogelzwitschern wird auf einmal wichtiger als die Zeitungen der Welt, ein Junge mit zerbrechlichen Augen wertvoller als Gold, ein Mädchen mit Lachgrübchen bedeutender als die gesamte britische Flotte. Natürlich redet Jens nicht von Vogelzwitschern und Lachgrübchen, das würde er niemals tun, aber nach drei Bier und einem Schnaps verliert der Postbote für Skúli als Quelle an Verlässlichkeit. Eine gewisse Sorglosigkeit wandelt ihn an, er verliert das Interesse an weltbewegenden Neuigkeiten, welche Armeeeinheiten sich wohin bewegen, ob der Statthalter der Krone noch auf seinem Posten sitzt oder gehen wird, ob er seinem unerfahrenen jungen Schwiegersohn die Pfarre von Þingvellir zuschanzt oder nicht.
Tut er’s?, fragt Skúli eifrig.
Du meine Güte, ist das jetzt wichtig? Am Ende kommt doch alles auf eins heraus, auf dem Klo sind alle gleich, meint Jens über seinem dritten Bier und beginnt, Kolbeinn wilde Geschichten von Páll zu erzählen, der auf der Suche nach seinen Augen, die Fuchs und Rabe gestohlen haben, über die Hochheide geistert. Er tut das, um dem alten Mann eine Freude zu machen; er selbst hat noch nie ein Gespenst gesehen. Die Lebenden machen einem Ärger genug, sagt er und trinkt.
Skúli rafft seine Blätter zusammen und erhebt sich.
Willst du das hier nicht lesen, fragt Jens. Er hat dichtes, blondes Haar und sähe gut aus, wenn er nicht eine so riesengroße Nase hätte. Hastig zieht er zwei Umschläge aus der Tasche und reicht sie Skúli. Es sind die Aussagen oder Atteste zweier Bauern, die bestätigen, dass Jens wegen schlechten Wetters und Unpassierbarkeit der Wege nicht schneller über die Berge kommen und deswegen den Zeitplan nicht einhalten konnte, sehr zum Verdruss von vielen, unter ihnen Skúli.
Ist nicht nötig, winkt der Redakteur kurz ab, nickt Helga zu, würdigt Kolbeinn und den Jungen keines Blickes, stutzt dann aber und fährt fast zusammen, als er Geirþrúður in der Tür hinter dem Schanktisch auftauchen sieht. Sie hat sich nicht die Mühe gemacht, ihr rabenschwarzes Haar aufzustecken. Es fließt ihr über die Schultern und über das grüne Kleid, das ihr so verdammt gut steht, dass Skúli auf dem Heimweg kaum an etwas anderes denkt. Er kämpft sich durch das Unwetter, den Kopf voller schwarzer Haare und einem grünen Kleid, und die Erregung tanzt um ihn her wie ein Sturm.
III
In den Wintern sind die Nächte dunkel und sehr still. Wir hören die Fische am Meeresgrund atmen, und wer auf die Berge oder auf die Hochheiden steigt, kann dem Gesang der Sterne lauschen. Irgendwo heißt es, der Gesang würde entweder Verzweiflung oder etwas Göttliches in einem wachrufen. Wenn man an stillen, völlig dunklen Abenden in die Berge geht und sich dort den Wahnsinn oder die Seligkeit holt, dann hat man vielleicht doch für etwas gelebt. Nicht viele nehmen solche Wanderungen auf sich. Man läuft teure Schuhe ab, und das Aufbleiben in der Nacht macht einen unfähig, die Arbeit des Tages zu erledigen. Und wer soll die Arbeit tun, wenn man selbst es nicht schafft? Der Überlebenskampf und die Träume passen nicht zusammen, Poesie und Salzfisch sind Gegensätze, keiner kann seine Träume essen.
So leben wir.
Der Mensch stirbt, wenn man ihm sein Brot wegnimmt, und er verwelkt ohne Träume. Worauf es ankommt, das ist selten kompliziert, und trotzdem mussten wir erst sterben, um zu einer so selbstverständlichen Einsicht zu kommen.
Im Flachland sind die Nächte nie so still wie auf den Bergen, der Sternengesang bleibt irgendwo auf der Strecke, aber still können die Nächte auch hier im Ort noch sein, wenn niemand unterwegs ist außer dem Nachtwächter, der die unzuverlässigen Straßenlaternen abläuft und dafür sorgt, dass sie nicht rußen und nur brennen, wenn es erforderlich ist. Jetzt liegt Dunkelheit über dem Ort, die Nacht teilt Träume, Albträume und Einsamkeit aus. Der Junge schläft tief in seinem Zimmer, hat sich unter der Decke zusammengerollt. Noch nie hat er in einem eigenen Bett geschlafen, bevor ihn Bárðurs Tod vor drei Wochen in dieses Haus trieb, und anfangs fiel es ihm schwer, in dieser Stille Schlaf zu finden; es gab keine nahen Atemzüge, kein unterdrücktes Husten, kein Schnarchen, keines der anderen Geräusche, wenn sich jemand herumwälzt, einen fliegen lässt oder tief im Schlaf seufzt. Hier entscheidet der Junge sogar allein, wann das Licht gelöscht wird, er kann daher so lange lesen, wie er Lust hat. Das ist eine Freiheit, die ihn schwindelig macht. Ich lösche jetzt das Licht, hat der Bauer früher gesagt, wenn er der Meinung war, alle in der gemeinsamen Wohn- und Schlafstube seien lange genug wach geblieben, und dann schlug die Dunkelheit zu. Wer zu lange aufbleibt, kann am nächsten Tag nicht vernünftig arbeiten, und wer seinen Träumen nicht folgt, verliert das Herz.
Langsam wird es hell.
Mond und Sterne verblassen, bald fließt der Tag über sie hinweg, das blaue Wasser des Himmels. Ein freundliches Licht, das uns hilft, durch die Welt zu finden. Trotzdem besitzt dieses Licht keine große Reichweite, von der Erdoberfläche reicht es lediglich ein paar Dutzend Kilometer in die Atmosphäre hinauf, dahinter beginnt die Nacht des Weltalls. Genauso verhält es sich wahrscheinlich mit dem Leben, diesem blauen See: Hinter ihm wartet der Ozean des Todes.
„Der Autor versteht es meisterhaft, (...) poetische Sequenzen in die Handlung einfließen zu lassen, die den Leser zwingen Sinn und Wert des Lebens zu hinterfragen.“
„Stefánsson erzählt diese Geschichte von zwei Männern im Eis packend wie einen Actionthriller, ohne dabei die Schönheit der Sprache, die Lust am Philosophieren und Fabulieren aus den Augen zu verlieren. Auf diese Weise werden 340 Seiten Schneetreiben an keiner Stelle langweilig.“
„In der kunstvollen, soghaften Beschreibung dieser Reise erlebt der Leser die sinnstiftende Wirkung, die Literatur und besonders die Poesie für den Jungen haben, auf einer anderen Ebene nach.“
„Stefánsson gelingt es, Worte für das Unbeschreibliche zu finden. (…) Die lyrisch unterfütterte Sprache ist es, die dieses Buch so eindrucksvoll macht.“
„Eine archaische, eine meisterhafte Abenteuergeschichte.“
„Eine Hommage an frühere Generationen, die zäh und unverdrossen um ihr überleben auf der gottverlassenen Nordmeerinsel kämpften.“
„Ein bewegender, stimmungsvoller Roman, in dem es um die großen Themen geht: die Liebe und den Tod.“
„Schlicht und ergreifend, wie Island leben.“
„Den Naturgewalten setzt der 47-jährige Autor, ein feinsinniger, wie bescheidener Mensch, die Kraft der Poesie entgegen: ›Wir sitzen in einem morschen Ruderboot mit ein brüchigen Netz und wollen Sterne fischen‹. Das ist der Roman ja selbst: ein hell leuchtender Stern.“
„›Der Schmerz der Engel‹ von Jón Kalman Stefánsson erzählt poetisch, wie er sich mit einem Waisenjungen, der ihn begleiten soll, allen Naturgewalten stellt. Dabei kommen sie den großen Fragen zu Liebe und Tod sehr nah.“
„Einer der besten isländischen Erzähler seit Halldór Laxness. Seine Romane sind reine Poesie.“
„Was fasziniert, ist die anspruchsvolle Sprache.“








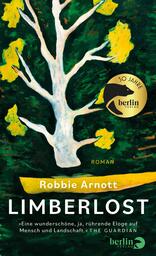








DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.