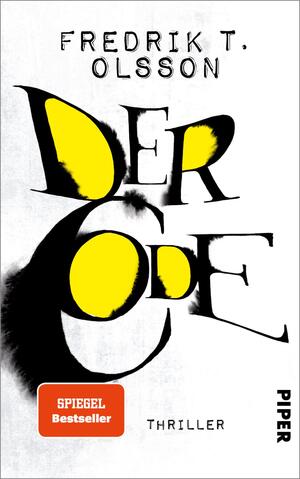
Der Code (William-Sandberg-Serie 1)
Thriller
„Ein Buch für Leser mit Spaß am ganz großen Weltuntergangstheater.“ - FOCUS
Der Code (William-Sandberg-Serie 1) — Inhalt
In Amsterdam fällt die junge Sumerologin Janine Haynes einem Verbrechen zum Opfer. Zur gleichen Zeit ermorden drei als Sanitäter getarnte Unbekannte in Berlin einen Obdachlosen. Und in Stockholm verschwindet der Kryptologe und Software-Experte William Sandberg spurlos aus seinem Klinikbett. Seine Ex-Frau Christiane will nicht an eine eigenmächtige Flucht glauben. Denn in seinem leer geräumten Appartement , entdeckt sie einen Gegenstand, den er nie zurücklassen würde. Sehr schnell gibt es keinen Zweifel mehr, dass William entführt wurde. Und dass es um die Entschlüsselung einer Botschaft geht, die in der DNA des Menschen verborgen liegt ... – „Der Code“, ein so intelligenter wie mitreißender Thriller über das Lüften eines jahrtausendealten Geheimnisses. Ein Thriller, wie es ihn noch nie gegeben hat.
Leseprobe zu „Der Code (William-Sandberg-Serie 1)“
Prolog
Als sie den Mann in der Gasse erschossen, war es schon zu spät. Er war knapp über dreißig, mit Jeans, Hemd und einer Windjacke bekleidet. Für diese Jahreszeit war er viel zu dünn angezogen, aber frisch geduscht und halbwegs satt – das hatten sie ihm versprochen, und sie hatten es auch gehalten. Doch niemand hatte ihm gesagt, was danach passieren würde. Keuchend blieb er zwischen den Steinfassaden hinter dem alten Postamt abrupt stehen. Im Rhythmus seiner Atemzüge stiegen dünne Dampfwolken in der Dunkelheit auf. Er spürte eine leise Panik, weil die [...]
Prolog
Als sie den Mann in der Gasse erschossen, war es schon zu spät. Er war knapp über dreißig, mit Jeans, Hemd und einer Windjacke bekleidet. Für diese Jahreszeit war er viel zu dünn angezogen, aber frisch geduscht und halbwegs satt – das hatten sie ihm versprochen, und sie hatten es auch gehalten. Doch niemand hatte ihm gesagt, was danach passieren würde. Keuchend blieb er zwischen den Steinfassaden hinter dem alten Postamt abrupt stehen. Im Rhythmus seiner Atemzüge stiegen dünne Dampfwolken in der Dunkelheit auf. Er spürte eine leise Panik, weil die Gitterpforte am Ende der kurzen Querstraße verschlossen war. Dieses Risiko war ihm bewusst gewesen, aber er hatte es in Kauf nehmen müssen. Jetzt stand er hier, ohne einen Fluchtweg, während sich von hinten das Rascheln der drei Warnwesten näherte. Bereits vor einer Viertelstunde hatte die Nachricht die europäischen Tageszeitungen erreicht, versteckt im großen Datenstrom, drei knappe Zeilen über einen Mann, der um kurz nach vier in der Nacht zum Donnerstag mitten in Berlin tot aufgefunden worden sei. Dort stand nicht ausdrücklich, dass es sich um einen Obdachlosen und Drogenabhängigen handelte, aber dieser Eindruck entstand, wenn man die Kurzmeldung las. So war es auch bezweckt. Wer glaubhaft lügen wollte, sollte sich an die Wahrheit halten. Aus Platzmangel würde die Notiz in den Ausgaben des nächsten Tages in einer Spalte zwischen anderen unbedeutenden Nachrichten verschwinden. Die Nachricht war nur eine von vielen Sicherheitsmaßnahmen, und vermutlich war sie nicht einmal notwendig. Lediglich eine Erklärung, falls irgendein Außenstehender beobachten würde, wie man den leblosen Körper in der Dunkelheit barg, ihn zum Rettungswagen trug, die Hintertür mit Schwung zugleiten ließ und durch den feinkörnigen Eisregen mit rotierendem Blaulicht davonfuhr. Jedoch nicht zu einem Krankenhaus. Genau genommen würde man im Krankenhaus ohnehin nichts mehr ausrichten können. In dem Rettungswagen saßen drei schweigende Männer, die hofften, dass sie rechtzeitig gekommen waren. Aber so war es nicht.
I – VIERERBASIS
Nichts würde mich je dazu bringen, Tagebuch zu schreiben.Dinge geschehen. Die Zeit vergeht. Das Leben beginnt und nimmt seinen Lauf und sein Ende, und an dieser Sinnlosigkeit ändert sich gar nichts dadurch, dass man sie aufschreibt und anschließend betrachtet. Eines Tages ist alles vorüber, und eines weiß ich sicher – wenn die Welt zusammenbricht, wird kein Schwein lesen wollen, was ich an einem Montag im März gemacht habe.Nichts würde mich je dazu bringen, Tagebuch zu schreiben.Mit einer Ausnahme:Wenn ich wüsste, dass es bald niemanden mehr geben wird, der es lesen kann.Dienstag, der 25. November.In der Luft liegt Schnee.Und in den Augen aller Schrecken.
1
Die Polizisten hatten nur Sekunden gebraucht, um die verzierten Flügeltüren zur Wohnung aufzubrechen, indem sie die bleigefassten Fensterscheiben einschlugen, hindurchgriffen und die Tür von innen öffneten. Was Zeit in Anspruch nahm, war das dahinterliegende Eisengitter. Es war schwer, mit einem Sicherheitsschloss versperrt und vermutlich irrsinnig teuer gewesen – und das Einzige, was sie jetzt noch daran hinderte, in die Wohnung zu gelangen und dem Mann mittleren Alters zu helfen, der sich den Angaben zufolge darin befand. Wenn er überhaupt noch am Leben war. Der Anruf war am frühen Vormittag bei der Polizei in Norrmalm eingegangen, und in der Zentrale hatte man einige Zeit verstreichen lassen, während man sich vergewisserte, ob die Anruferin glaubhaft und nüchtern war und es ernst meinte. Ob sie den Mann kenne? Ja, das tue sie. Ob er sich möglicherweise woanders aufhalte? Nein, das sei undenkbar. Wie lange sie ihn schon vermisse? Noch nicht lange, erst gestern Abend hätten sie miteinander telefoniert, und er sei sehr verschlossen gewesen und habe immer wieder vom Thema abgelenkt. Und das habe sie erschreckt – wenn er jammerte, könne sie das einschätzen, aber diesmal sei er tapfer gewesen und habe sich bemüht, möglichst positiv zu klingen, und sie habe nicht genau feststellen können, woran das lag. Es schien, als hätte er etwas zu verbergen. Und als sie an diesem Vormittag angerufen habe und er nicht ans Telefon gegangen sei, habe die Einsicht sie schlagartig getroffen: Diesmal hatte er es wirklich getan. Die Frau hatte ihr Anliegen wohlartikuliert und präzise formuliert, und nachdem sie den Mann in der Zentrale endlich überzeugt hatte, alarmierte dieser eine Streife und den Rettungswagen und nahm das nächste Gespräch an. Schon als die ersten Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass die Frau vermutlich recht hatte. Die Eingangstür war abgeschlossen. Hinter dem gefärbten Glas zeichnete sich das Gitter wie ein verschwommenes Muster ab. Aus der Wohnung drang leise klassische Musik und mischte sich mit dem Plätschern von Wasser, das vermutlich gerade aus einer Badewanne überlief. Ein ziemlich schlechtes Zeichen. Zwei Stufen unter dem Absatz in dem eleganten Treppenhaus stand Christina Sandberg, den Blick starr durch das schwarz lackierte Stahlgitter des Aufzugschachts gerichtet, gebannt von jeder Bewegung dort drüben an der Eingangstür zu jener Wohnung, in der sie einmal gewohnt hatte. Gelb glühende Metallspäne regneten vom Schneidbrenner des Schlossers hinab, während er das verdammte Eisengitter bearbeitete, gegen das sie sich so lange gewehrt hatte, bis sie nach jenem alles verändernden Abend gezwungen gewesen war, ihm zuzustimmen. Also hatten sie es einbauen lassen – um sich zu schützen. Und heute würde es womöglich seinen Tod bedeuten. Wäre sie nicht so schrecklich besorgt, dann wäre sie schrecklich wütend. Hinter dem Schlosser standen vier Polizisten, die beherrscht von einem Bein aufs andere traten, weil sie darauf warteten, etwas unternehmen zu können, dahinter zwei ebenso rastlose Rettungssanitäter. Anfangs hatten sie nach ihm gerufen – „William!“, hatten sie gerufen, „William Sandberg!“ –, doch es kam keine Antwort, und schließlich hatten sie es aufgegeben und stumm den Schweißbrenner seine Arbeit tun lassen. Und Christina konnte nur zusehen. Sie war als Letzte eingetroffen. Hatte zuvor hastig ihre Jeans und ihren Wildledermantel angezogen, ihre diskret blondierten Haare zu einem Zopf zusammengebunden und war ins Auto gesprungen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits mehrfach versucht, ihn zu erreichen, das erste Mal direkt nach dem Aufstehen, das zweite Mal auf dem Weg in die Dusche und dann noch einmal, bevor sie ihre Haare geföhnt hatte. Anschließend hatte sie bei der Polizei angerufen und eine Ewigkeit gebraucht, um den Mann in der Zentrale von dem zu überzeugen, was sie längst wusste. Was ihr tief in ihrem Inneren schon beim Aufwachen klar gewesen war, sie aber genauso zu verdrängen versucht hatte wie das schlechte Gewissen, das sie stets überkam, sobald sie miteinander telefonierten. Eigentlich hasste sie sich dafür, dass sie den Kontakt mit ihm noch immer hielt. Ihn hatte es schwerer getroffen als sie, nicht weil sie weniger trauerte, sondern weil er sich der Trauer mehr hingab, und selbst nach zwei Jahren der Grübeleien und Diskussionen und Überlegungen über das „Warum“ und das „Was wäre, wenn“ ergab sich heute noch das gleiche Bild. Ihr wurde die große Ehre zuteil, ihrer beider Trauer zu verarbeiten plus eine Extraportion Schuldgefühle zu bewältigen, und diese Verteilung fand sie ungerecht. Aber das Leben war nicht gerecht. Wenn es das wäre, würde sie jetzt nicht hier stehen. Schließlich gab das Gitter nach, und die Polizisten und Sanitäter stürmten vor ihr in die Wohnung, und dann geriet die Zeit aus den Fugen. Die Rücken verschwanden den langen Flur hinunter, und nach einer unerträglichen Anzahl von Sekunden oder Minuten oder Jahren hörte sie, wie dort drinnen die Musik ausgestellt wurde, danach das Wasser, und anschließend war es vollkommen still, und so blieb es auch. Bis sie endlich wieder herauskamen. Ihrem Blick auswichen, während sie sich um die Ecke schoben, aus dem Flur heraus, über den schmalen Absatz am Aufzug vorbei, um die steile Kurve des runden Treppenaufgangs, ohne gegen die teuren, mit Stuck versehenen Wände zu stoßen, und dann hinuntergingen, schnell, aber vorsichtig, behutsam und doch eilig. Christina Sandberg presste sich gegen das Stahlgitter des Aufzugs, um die Trage durchzulassen, die zu dem auf dem Bürgersteig wartenden Rettungswagen transportiert wurde. Darauf lag, mit einer glänzenden Sauerstoffmaske aus Plastik, der Mensch, den sie einmal ihren Mann genannt hatte. William Sandberg wollte eigentlich nicht sterben. Oder besser gesagt: Es war nicht seine erste Wahl. Lieber wollte er leben, es sich gut gehen lassen, ein annehmbares Leben führen, wollte das Vergessen lernen, einen Grund finden, jeden Morgen aufzustehen und sich anzuziehen, und etwas tun, was eine Bedeutung hatte. Eigentlich brauchte er nicht einmal all das. Ein kleiner Teil davon hätte schon gereicht. Er wünschte sich lediglich einen Anlass, um nicht mehr an das zu denken, was so sehr schmerzte. Den hatte er allerdings nicht bekommen, und die einzige Alternative auf seiner Liste bestand darin, allem ein Ende zu bereiten. Offenbar war ihm nicht einmal das geglückt. „Wie geht es Ihrem Körper?“, fragte die junge Krankenschwester, die vor ihm stand. Er saß bereits halb aufgerichtet unter dem steifen gemangelten Bettzeug, auf altmodische Weise gebettet, mit einem weißen Laken, das um eine gelbe Klinikwolldecke geschlagen war, als würde man in der Krankenpflege noch immer die Erfindung des Bettdeckenbezugs leugnen. Er sah sie an. Versuchte zu verbergen, wie sehr ihn das diffuse Unbehagen über all die Gifte plagte, die sich noch immer in seinem Körper befanden. „Schlechter, als Sie es sich wünschen“, sagte er. „Besser, als ich es mir vorgestellt hatte.“ Darüber lächelte sie, was ihn verwunderte. Sie war höchstens fünfundzwanzig, blond und außerdem sehr niedlich. Vielleicht lag das aber auch nur an dem sanften Gegenlicht, in dem sie vor dem Fenster stand. „Scheint so, als wäre die Zeit diesmal noch nicht reif gewesen“, erwiderte sie. Sie sagte es ungerührt, fast im Plauderton, und auch das erstaunte ihn. „Es wird nicht die letzte Chance gewesen sein“, meinte er. „Das ist doch gut“, entgegnete sie. „Man sollte immer optimistisch bleiben.“ Ihr Lächeln war perfekt abgewogen: breit genug, um die Ironie in ihren Antworten zu unterstreichen, aber nicht so breit, dass es den trockenen Humor zwischen ihnen zerstört hätte. Und plötzlich hatte er keine Antwort mehr parat und wurde von dem unangenehmen Gefühl beschlichen, dass das Gespräch nun vorüber war und sie gewonnen hatte. Einige Minuten lag er schweigend da und beobachtete sie bei der Arbeit. Routinierte Bewegungen, ein vorgegebenes Schema: Der Tropfbeutel musste gewechselt werden, die Menge reguliert, Werte notiert und in der Krankenakte vermerkt werden. Es war eine stille Effektivität, und irgendwann begann er zu überlegen, ob er das Gespräch womöglich missverstanden hatte und sie in Wirklichkeit überhaupt nicht mit ihm gescherzt hatte. Schließlich hatte sie alle Aufgaben erledigt. Richtete nur noch pflichtschuldig sein Laken, ohne eine Veränderung zu bewirken, und hielt dann inne. „Machen Sie bloß keine Dummheiten, wenn ich weg bin“, sagte sie. „Solange Sie noch hier sind, bescheren Sie uns damit nur unnötig Arbeit.“ Sie zwinkerte ihm zum Abschied freundschaftlich zu, schlüpfte in den Flur hinaus und ließ den Kugeldruckmechanismus die Tür schließen. William blieb im Bett zurück und fühlte sich unangenehm berührt. Nicht, weil es einen triftigen Grund dafür gab. Er war lediglich unangenehm berührt. Warum? Weil sie nicht in dem behutsamen Tonfall mit ihm gesprochen hatte, über den er sich gern geärgert hätte? Oder weil ihre trockenen Kommentare so überraschend gekommen waren, dass er es sich für einen Augenblick erlaubt hatte, herausgefordert, ja beinahe amüsiert zu sein? Nein. Es dauerte einen Moment, ehe er es wusste. Er schloss die Augen. Biss die Zähne zusammen. Es war der Humor. Genau derselbe Humor. All das hätte sie exakt genauso gesagt. Plötzlich störte ihn dieses unbestimmte Surren von all den Giften in seinem fünfundfünfzigjährigen Körper überhaupt nicht mehr, genauso wenig wie der brennende Schmerz von der Schnittwunde unter der Gazebinde, mit der man seine Handgelenke verbunden hatte. Stattdessen plagte ihn etwas anderes. Jenes Gefühl, das ständig zurückkehrte und ihn immer, wenn er es verdrängte, mit doppelter Wucht traf, das Gefühl, das ihn gestern dazu veranlasst hatte, ins Badezimmer zu gehen und eine endgültige Entscheidung zu treffen. Zum wievielten Mal, das konnte er selbst nicht mehr sagen. Denn er hatte damals die Zeichen nicht deuten können. Anders konnte er es nicht formulieren, so ironisch es auch klingen mochte. Ausgerechnet er. Konnte die Zeichen nicht deuten. Verflucht. Er hätte die Schwester um ein Beruhigungsmittel bitten sollen. Oder etwas Schmerzstillendes oder Valium oder noch besser einen Kopfschuss, aber mit Letzterem konnte sie ihm wohl nicht dienen. Er befand sich an derselben Stelle wie gestern Abend: dieser endlose Fall durch die dunkle Röhre, die kein Ende nehmen wollte, diese destruktive Sehnsucht danach, wenigstens den Boden zu erreichen und sich hoffentlich erfolgreich umzubringen und all die Gedanken loszulassen, die immer wieder die Kontrolle über ihn erlangten. Die ihm kleine Hoffnungsmomente schenkten, nur um ihn anschließend wieder mit voller Kraft zu ohrfeigen und ihm zu zeigen, dass sie die Macht hatten, nicht er. Er streckte sich nach dem Kabel, das an der Wand hing, und zog den tubenförmigen Knopf zu sich heran, um Hilfe zu rufen. Er hoffte, dass nicht dieselbe Schwester zurückkommen würde, es wäre eine ärgerliche Niederlage, wenn er sich vor ihr von einem bissigen und eloquenten Patienten in einen Jammerlappen verwandeln musste, der sie um ein Schlafmittel anbettelte. Aber wenn er dadurch ein wenig Ruhe fand, war es ihm das trotzdem wert. So dachte er und drückte auf den Knopf. Zu seinem Erstaunen ertönte jedoch kein Signal. Er drückte noch einmal darauf, diesmal länger. Wieder nichts. Vielleicht war das logisch, redete er sich ein. Schließlich klingelte er nicht nach sich selbst. Es reichte ja, wenn der Alarm im Schwesternzimmer ertönte, damit jemand nach dem Rechten sah. Dann fiel sein Blick auf die Alarmleuchte an der Wand, aus der das Kabel mit dem Schalter herauskam. Müsste denn nicht wenigstens sie blinken? Wenn er schon kein Signal hörte, sollte dann nicht die Lampe leuchten, um ihm zu zeigen, dass er richtig gedrückt hatte? Erneut betätigte er den Ruf. Und noch einmal. Doch nichts passierte. Er war so sehr von der defekten Alarmfunktion abgelenkt, dass er vor Schreck zusammenzuckte, als die Tür aufging. Blinzelnd schaute er hinüber und versuchte sich zwischen Angriff und Verteidigung zu entscheiden: Sollte er darüber schimpfen, dass die Lampe kaputt war, oder sich entschuldigen, weil er so hysterisch geklingelt hatte? Weiter kam er nicht, ehe sich seine Augen an das Gegenlicht gewöhnt hatten und beide Alternativen verpufften. Der Mann, der jetzt am Fußende des Betts stand, war weder Arzt noch Krankenpfleger. Er trug einen Anzug und ein Hemd, aber keine Krawatte, und ein paar grobe Stiefel, die im Vergleich zu seiner übrigen Kleidung überproportioniert wirkten. Vermutlich war er um die dreißig, obwohl sich das Alter von kahl geschorenen Männern immer schwer schätzen ließ, vor allem, wenn ihre Körperhaltung so eindeutig verriet, wie durchtrainiert sie waren. „Sind die für mich?“, fragte William, weil ihm nichts Besseres einfiel. Er deutete mit einem Nicken auf die Blumen, die der Anzugträger in den Händen hielt, und der blickte auf den Strauß hinab, als hätte er sein Präsent noch gar nicht wahrgenommen. Er antwortete nicht und warf die Blumen achtlos ins Waschbecken. Sie waren nur eine Tarnung gewesen, um sich unauffällig durch die Korridore vorzuarbeiten. „William Sandberg?“, fragte er. „Um eine Haaresbreite nicht mehr“, antwortete William. „Aber ja.“ Die ganze Situation war äußerst merkwürdig, und William spürte allmählich eine innere Anspannung. Der Mann, der weder Arzt war noch ein Bekannter, blieb schweigend stehen, während sie sich gegenseitig musterten. Sich gegenseitig taxierten, so schien es, obwohl William von seinem Krankenlager aus schwerlich Widerstand hätte leisten können. „Wir haben versucht, Sie zu erreichen“, sagte der Fremde schließlich. Ach ja? William versuchte nachzuvollziehen, was der Mann meinte. Er konnte sich nicht entsinnen, dass ihn in letzter Zeit irgendjemand kontaktiert hatte, andererseits war er sich auch nicht sicher, ob er es in diesem Fall überhaupt bemerkt hätte. „Ich musste über einige Dinge nachdenken.“ „Das haben wir verstanden.“ Wir? Was zum Teufel war das hier? William richtete sich ein wenig auf und rang sich ein trockenes Lachen ab. „Ich würde Ihnen ja gern etwas anbieten, aber man ist hier nicht so großzügig mit dem Morphium, wie ich gehofft hatte …“ „Wir werden Ihre Hilfe benötigen.“ Das kam plötzlich, ein wenig zu schnell, und in der Stimme des Mannes schwang etwas mit, das William dazu brachte, seinen Widerstand für einen Moment aufzugeben. Der Jüngere sah ihn mit einem Blick an, der nach wie vor fest wirkte, aber doch mehr offenbarte. Dringlichkeit. Vielleicht sogar Furcht. „Dann bin ich die falsche Person für Sie, glaube ich“, sagte William und machte eine resignierte Geste. Jedenfalls so gut es ging. Der Tropfschlauch und die Kabel des EKGs schränkten seine Bewegungsfähigkeit ein, und das verstärkte nur umso mehr, was er hatte sagen wollen: William Sandberg war kaum dazu in der Lage, irgendjemandem bei irgendetwas behilflich zu sein. Aber der durchtrainierte Mann schüttelte den Kopf. „Wir wissen, wer Sie sind.“ „Und was heißt wir?“ „Das ist nicht wichtig. Wichtig sind Sie. Wichtig ist das, was Sie können.“ Das Gefühl, das sich in Williams Körper ausbreitete, war vertraut und doch unerwartet. Mit einem solchen Gespräch hätte er vor zehn Jahren gerechnet oder eher vor zwanzig. Dann wäre er darauf vorbereitet gewesen. Aber heute? Der Mann am Fußende des Bettes sprach ausgezeichnet Schwedisch, aber irgendwo im Hintergrund schwang ein leiser Akzent mit. Zu versteckt, um ihn einzuordnen. Aber es war definitiv ein Akzent. „Von wem kommen Sie?“ Der Jüngling sah ihn an. Mimte Enttäuschung. Als müsste William einsehen, dass er darauf keine Antwort erhalten würde, und als wäre die Frage unter seinem Niveau. „Von der Sicherheitspolizei? Vom Militär? Von einer fremden Macht?“ „Tut mir leid. Das kann ich nicht sagen.“ „Gut“, meinte William. „Dann richten Sie doch bitte unbekannterweise schöne Grüße und besten Dank für die Blumen aus.“ Er sagte es in einem abschließenden Ton: Das Gespräch war beendet, und um das zu unterstreichen, hob er erneut das Kabel mit dem Signalknopf. Drückte mit dem Daumen darauf, lange, den Blick auf den jungen Mann gerichtet, um zu demonstrieren, für wie außerordentlich beendet er das Gespräch hielt. Doch auch diesmal passierte nichts. „Wenn es funktionieren würde, hätten Sie es an der Lampe gesehen“, erklärte der Mann. Unerwartet. William schaute ihn an. Ein weiterer Augenblick verging damit, dass sie mit Blicken ihre Kräfte maßen, und dann ließ William das Kabel los, sodass es auf seinen Bauch fiel, quer über die gelbe Klinikdecke. „Ich bin fünfundfünfzig“, sagte er. „Ich habe schon seit mehreren Jahren nicht mehr gearbeitet. Ich bin wie eine alte Festung: Vor langer Zeit war ich einmal wichtig, heutzutage bin ich nutzlos und verfalle.“ „Meine Chefs sind zu einer anderen Einschätzung gekommen.“ „Und wer sind Ihre Chefs?“ Er fragte es mit scharfer Stimme. Inzwischen war er das Gespräch leid, er wollte endlich seine Schlaftabletten haben und für eine Weile abtauchen, anstatt mit diesem muskelbepackten Welpen Kalter Krieg zu spielen. Doch es war der Jüngling, der das Gespräch schließlich beendete. „Es tut mir leid“, sagte er noch einmal. Seufzte bedauernd, ehe er sein Gewicht verlagerte und sich umdrehte. Um zu gehen, dachte William. Das merkwürdige Ende einer merkwürdigen Begegnung. Als der Mann die Tür zum Korridor öffnete, standen draußen allerdings zwei weitere Männer, die darauf warteten hereinzukommen. In der Hand des einen blitzte ein teurer Füllfederhalter. Es war zehn Minuten nach eins, als das Ärzteteam durch die hallenden Flure der Intensivstation des Karolinska-Krankenhauses marschierte, um nach den Patienten zu sehen. Den ersten Teil der Visite hatten sie ohne größere Überraschungen erledigt, und der nächste Patient war ein Mann, der versucht hatte, sich das Leben zu nehmen: eine Tablettenvergiftung und Schnittwunden an den Handgelenken. Kaum ein Grund für einen längeren Aufenthalt. Er hatte eine Bluttransfusion bekommen, um den Blutverlust auszugleichen und die hohe Medikamentenkonzentration in seinem Körper zu verdünnen, aber er war nicht in Lebensgefahr gewesen, als man ihn eingeliefert hatte, sodass er entweder zu wenig Pillen geschluckt oder einen der vielen riskanten Selbstmordversuche unternommen hatte, mit denen Menschen lediglich die Aufmerksamkeit ihrer Angehörigen auf sich ziehen wollen. Wie auch immer, es bestand jedenfalls kein Zweifel daran, dass er bald nicht mehr in ihre Zuständigkeit fallen würde, und Doktor Erik Törnell blieb vor der Tür stehen, klappte die Akte zu, in der er soeben geblättert hatte, und signalisierte den Kollegen mit einem knappen Nicken: Dies würde ein kurzer Besuch werden. Das Erste, was sie sahen, als sie das Zimmer betraten, war das leere Bett. Ein Blumenstrauß lag im Waschbecken, die Vase war vom Nachttisch gefallen und zerbrochen, die Wolldecke war auf den Boden gerissen worden, und der Schlauch des Tropfes baumelte frei vom Gestell. Das Badezimmer war leer. Aus dem Schrank war das gesamte Hab und Gut des Patienten entfernt worden. Und die Schublade in der kleinen Kommode hatte man herausgezogen und umgedreht. William Sandberg war weg. Nach einer einstündigen Suche musste man feststellen, dass er sich überhaupt nicht mehr auf dem Klinikgelände befand – und dass niemand sagen konnte, warum.
So einen Thriller wie „Der Code“ hat es noch nie gegeben. Es geht um ein jahrtausendealtes Geheimnis, die letzten Tage der Menschheit und ein Rennen um die Zeit. Mittendrin eine junge Wissenschaftlerin und ein Kryptologe, die das große Rätsel entschlüsseln sollen.
Sie müssen einfach nur die Menschheit retten. Aber das wissen sie noch nicht, als sie von einer geheimen Organisation in ein Schloss in den Alpen entführt werden: die junge Sumerologin Janine Haynes und der Kryptologe William Sandberg. In der gigantischen Anlage treffen sie auf Connors und Franquin. Sie gehören zu den Entführern und leiten offenbar für eine Weltorganisation ein Großprojekt, an dem sie seit 30 Jahren arbeiten. Doch Informationen über das Projekt geben sie nicht preis. Noch nicht. Aber nach und nach erfahren die Amerikanerin und der Schwede, was sie zu tun haben: Sie sollen beim Entschlüsseln eines Codes helfen. Widerwillig und abgeschottet vom Rest der Welt machen sie sich an ihre Aufgabe.
Während Haynes und Sandberg über alte Keilschriften tüfteln, passieren merkwürdige Dinge draußen in der Welt: In Berlin wird ein Obdachloser verfolgt, ermordet und sauber entsorgt. Und in Stockholm stirbt ein Autofahrer während der Fahrt und verursacht dadurch eine Massenkarambolage. Es sind Zeichen. Bedrohliche Zeichen für die gesamte Menschheit.
Thriller mit ein bisschen Mystery und ein bisschen Science-Fiction
„Der Code“ von Fredrik T. Olsson ist kein Spionagethriller im eigentlichen Sinn. Es geht nicht um Interessen einzelner Länder oder um Bedrohungen durch Terroristen. „Mein Roman ›Der Code‹ ist ein bisschen Spionage, ein bisschen Mystery und ein bisschen ‚Wer-weiß-Was-und-Warum“, sagte kürzlich Olsson in einem Interview. Und vielleicht sogar ein bisschen Science-Fiction. Denn nach und nach erhalten Haynes und Sandberg Hinweise, dass sie einen Code der menschlichen DANN entschlüsseln sollen. Aber warum? Connors und Franquin schweigen oder antworten rätselhaft: „Es gibt ein Wissen, das nicht für uns bestimmt ist.“
Aussichtslose Flucht und die Entdeckung der Vorgängerin Haynes und Sandberg versuchen zu fl iehen. Ein aussichtsloser Versuch. Ein ausgeklügeltes Hochsicherheitssystem verhindert das. Bei ihrem Fluchtversuch entdecken sie jedoch eine sterbende Frau, die durch Plexiglasscheiben von der Außenwelt getrennt ist. Janine Haynes erkennt sie: Es ist die deutsche Wissenschaftlerin Helena Watkins, die vor Sandberg am Code gearbeitet hat. Schließlich werden Janine und William von den Sicherheitsleuten gestellt und anschließend unter mörderischen Qualen desinfiziert. Was hat das alles mit dem Code zu tun? Für wen arbeiten sie eigentlich? Connors und Franquin klären sie auf. Es ist eine unglaubliche Geschichte: Jeder menschliche Code enthält ein und dieselbe Botschaft. Es ist die Geschichte der Menschheit – vom Bau der ägyptischen Pyramiden über die Tsunami-Katastrophe 2004 bis zum Ende der Menschheit. Und das wird bald stattfinden. Sehr bald. Connors und Franquin wissen das seit mehr als 30 Jahren, in denen sie daran arbeiten, das schreckliche Ende abzuwenden. Ihre geheime Organisation hat daher in den Katakomben des Alpenschlosses ein Virus entwickelt, das die geheime Botschaft in der DNA eliminieren sollte. Doch das Virus verfehlte seine Wirkung. Stattdessen drang es nach draußen, ist nun virulent und infi ziert die Menschen. Haynes und Sandberg sind fassungslos. Die Menschheit weiß noch nicht, was ihr droht. Doch die Stunde Null naht: In Amsterdam stürzt ein Flugzeug ab und radiert dabei ein Stadtviertel komplett aus, ebenso wird dort ein Krankenhaus mit all seinen Patienten von einer F16-Maschine in Schutt und Asche gelegt, einen Tag später muss der Berliner Hauptbahnhof evakuiert werden. Der Virus grassiert. Die Menschen fliehen vor dem Tod. Weltweit herrschen apokalyptische Zustände. Die letzten Tage der Menschheit scheinen angebrochen zu sein. Dann hat Sandberg, der Spezialist für komplexe Geheimcodes, plötzlich einen ganz einfachen Gedanken: Ja, was wäre wenn wir nie entdeckt hätten, was wir in uns tragen. Es ist die Lösung des großen Rätsels und der schlüssige Showdown eines Thrillers, wie es ihn noch nie gegeben hat.
„Ein unglaublich spannender Thriller, der raffiniert erzählt ist“
„Ein so intelligenter wie mitreißender Thriller über das Lüften eines jahrtausendealten Geheimnisses.“
„Dem Leser ist Nervenkitzel garantiert. Er legt das Buch so schnell nicht mehr aus der Hand.“
„Der Schwede Fredrik T. Olsson hat ein fesselndes Thrillerdebüt mit Science-Fiction-Anklängen geschaffen. ›Der Code‹ erinnert an Frank Schätzings Bestseller ›Der Schwarm‹. So unrealistisch die Geschichte klingt, unmöglich wäre sie nicht.“
„Mit rätselhaften Handlungssträngen, überraschenden Wendungen und intelligenten Ermittlungen trotzt Olsson dem blutigen und melancholischen Schweden-Krimi-Klischee und liefert stattdessen einen abwechslungsreichen, apokalyptischen Thriller. Gut und Böse, Fiktion und Realität verschwinden im Spiel um Macht und Ohnmacht.“
„Olsson zeichnet viele interessante Figuren. Besonders gut gelingt die Gegenseite, in Thrillern oft die Schwachstelle mit tumben Bösen.“
„Dieses Buch ist Spannung pur! Hervorragend aufgebaut und geschrieben, fesselt es den Leser bereits ab der ersten Seite und lässt einen bis zum Schluss nicht mehr los. (...) Tolles Buch, interessantes Thema - insgesamt ein klasse Thriller!“
„›Der Code‹ punktet nicht nur mit einem außergewöhnlichen und gut konstruierten Plot, sondern schafft es auf überaus unterhaltsame Weise, Wissenschaftsgläubigkeit und menschliche Allmachtsgedanken zu hinterfragen.“
„Dass Olsson bisher Drehbücher geschrieben hat, erweist sich als Gewinn. Der Leser verfolgt die rasch vorangetriebene Handlung wie einen Kinofilm. Ein großes Vergnügen!“
„Ich konnte kaum glauben, dass ›Der Code‹ ein Debüt ist, so geschliffen, spannend aber auch an den richtigen Stellen feinsinnig ist der Stil.“
„Eine Geschichte, die so tatsächlich passieren könnte und genau deshalb für Gänsehautfeeling sorgt.“
„Tatsächlich ist ›Der Code‹ eine kleine Sensation im Thriller-Genre. Fesselnd, mitreißend und dazu noch intelligent.“
„Mitreißend wie ein Wasserfall.“
„Ein unglaublicher Wettlauf gegen die Zeit – Fredrik T. Olsson hat einen umwerfenden Thriller geschrieben, vielleicht einen der besten aus Schweden.“
„Raffiniert komponierter Thriller“
„Ein Buch für Leser mit Spaß am ganz großen Weltuntergangstheater.“
„Ein wirklich rasantes und spannendes Thriller-Debüt, eine überaus geschickte Mischung aus Fiktion und Realität.“





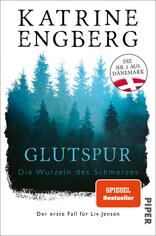

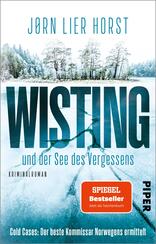





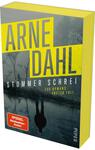
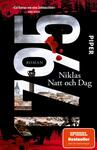
Jetzt habe ich das Buch vom Schweden „Der Code“ doch tatsächlich durchgelesen! Und ich ärgere mich so darüber, dass ich es gar nicht sagen kann. So ein Schwachsinn!!! Das ist des Piper-Verlags nicht würdig. Wenn es von einem anderen Verlag, der bekannt für derartigen Blödsinn ist, gewesen wäre, könnte man es mit Augenzwinkern unter „Trash“ ablegen. Aber Ihr Verlag hat mir wirklich immer dermassen imponiert. Und auf der Webseite auch noch zu schreien: „Ein Thriller, wie es ihn noch nie gegeben hat!“ Was soll denn das wohl? Die Amis haben das ja wohl längst durchgespielt: ein Weltuntergangsszenario, das nur in den Vereinigten Staaten stattfindet und von dort kommt auch die Rettung der gesamten Menschheit. Die Idee wäre ja vielleicht noch ganz gut gewesen, aber mit den vielen Längen zwischendurch, den absurden Schlussfolgerungen und den hanebüchenen Beschreibungen im Detail… Was macht es wohl für einen Sinn, zwei Wissenschaftler zu töten, die in einem Auto in der Wüste gefangen gehalten werden, wenn man im Glauben ist, dass die Menschheit ausgelöscht wird? Das ist ja wohl selten blöd. Die Schweiz ist zwar klein und Liechtenstein auch, aber wenn man mit einem Auto durch die Dörfer fährt ist es lange noch nicht gesagt, dass man sich zufällig begegnen kann. Von den Verletzungen, die sich Janine bei dem Entkommen aus dem Audi zugezogen hat, ist auch nicht mehr die Rede. Wie würde Schwarzenegger argumentieren? „War nur ne Fleischwunde…“ Dergleichen Unzulänglichkeiten könnte ich noch mehr und mehr aufzählen, in letzter Konsequenz deshalb, damit sie sehen, dass ich es wirklich gelesen habe. Noch nie habe ich eine negative Kritik geschrieben, denn auf ein schlechtes Buch braucht ja nicht hingewiesen zu werden. Aber hier muss ich mal Dampf ablassen! Nicht, dass der Verlag sich zum Schlechten verändert! Zum Glück habe ich noch ein Taschenbuch aus Ihrem Verlag liegen, das auf eine grossartige Kritik wartet. Die werde ich vielleicht noch ein bisschen vor mir herschieben bis ich aus dieser miesen Laune heraus bin. Heike Suter
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.