
Das Netz (William-Sandberg-Serie 2)
Thriller
„Ein Buch, das man nicht aus der Hand legen kann.“ - Peiner Allgemeine Zeitung
Das Netz (William-Sandberg-Serie 2) — Inhalt
Blackout, eine ganze Nacht steht in Stockholm alles still. Es herrschen Dunkelheit und Chaos. Die Regierung macht den Cyber-Experten William Sandberg dafür verantwortlich und nimmt ihn fest. Aber William ist ein gebrochener Mann: Seine Tochter ist spurlos verschwunden, und seine obsessive Suche nach ihr droht seine Ehe zu zerstören. Kurz vor dem Blackout erhielt er die mysteriöse E-Mail eines Unbekannten – William begreift sofort, das er fliehen und den Absender dieser Nachricht finden muss, um seine Unschuld zu beweisen. Doch sein Gegner scheint all seine Schritte schon zu kennen … Nach seinem internationalen Bestseller „Der Code“ der zweite Thriller von Fredrik T. Olsson.
Leseprobe zu „Das Netz (William-Sandberg-Serie 2)“
PROLOG
1
Er dachte vor allem an sein Aussehen.
Und das lag nicht an seiner Eitelkeit. Im Gegenteil: Sein Gesicht war rau und nachlässig gepflegt, und so hatte es schon immer ausgesehen. Jetzt war es außerdem noch wund, und unter den sorgfältig getrimmten Bartstoppeln spannte die rot gefleckte Haut, obwohl die Rasur schon mehrere Tage zurück lag.
Es war so ungewohnt, dieses Gesicht. So ungewohnt, sich darum zu kümmern, es herzurichten, auszustaffieren, als wäre es ein Schaufenster und die übrige Welt bestände aus potenziellen Kunden, die angelockt werden [...]
PROLOG
1
Er dachte vor allem an sein Aussehen.
Und das lag nicht an seiner Eitelkeit. Im Gegenteil: Sein Gesicht war rau und nachlässig gepflegt, und so hatte es schon immer ausgesehen. Jetzt war es außerdem noch wund, und unter den sorgfältig getrimmten Bartstoppeln spannte die rot gefleckte Haut, obwohl die Rasur schon mehrere Tage zurück lag.
Es war so ungewohnt, dieses Gesicht. So ungewohnt, sich darum zu kümmern, es herzurichten, auszustaffieren, als wäre es ein Schaufenster und die übrige Welt bestände aus potenziellen Kunden, die angelockt werden sollten.
Sein Aussehen und das der anderen hatte ihn bisher einfach nicht interessiert. Was ihn faszinierte, war die Innenansicht. Nicht in der küchenpsychologischen Version, der zufolge die wahre Schönheit von innen kommt, sondern im wortwörtlichen Sinn: Alle bedeutenden Dinge kamen von dort, Ideen, Gedanken, alles, was ein Individuum erst zu einem Individuum werden ließ.
Und natürlich das andere. Das Dunkle, die vielen negativen Kräfte, die er im Laufe der Zeit sorgfältig studiert und erfasst hatte und für die er mittlerweile fast so etwas wie Bewunderung empfand. Ausgerechnet diese Dinge waren jetzt in sein Leben getreten und hatten an Bedeutung gewonnen.
Reglos saß er einen Moment in der Stille. Er hörte nur seinen eigenen Puls und den trommelnden Rhythmus der Regentropfen auf dem Wagendach.
Dieses Trommeln hörte er. Und ein schwaches Zischen, das nur eines bedeuten konnte.
Er hatte aufgehört, am Türgriff zu zerren. Er hatte aufgehört, sich mit der Schulter gegen die Innenseite der Wagentür zu stemmen, weil er eingesehen hatte, dass es keinen Sinn machte. Der Wagen war verschlossen und würde ihn niemals freigeben. Ihm blieb nur noch eine Möglichkeit, nämlich den Sicherheitsgurt zu öffnen, sich quer über die Sitze zu legen und mit aller Kraft gegen die Fensterscheibe zu treten. Wobei auch diese seinem Kraftaufwand vermutlich standhalten würde.
Er war entdeckt worden.
Das war die einzige Erklärung, obwohl es genau genommen gar nichts erklärte. Niemand konnte wissen, dass er hier war, noch nicht einmal er selbst hatte es vorher gewusst. Erst vor zwei Tagen hatte er sich entschieden, er hatte mehrere Reisen zu unterschiedlichsten Zielen gebucht, die Transportmittel ständig geändert und Tickets abgeholt, die er niemals benutzen würde. Mit Bedacht und Absicht hatte er jede Entscheidung in allerletzter Sekunde getroffen. Trotzdem konnte er das Gefühl nicht abschütteln, dass jemand die ganze Zeit seine Gedanken gelesen hatte.
Natürlich war das unmöglich. Wer, wenn nicht er, hätte das wissen sollen, und trotzdem jagte ihm die Vorstellung einen Schauer über den Rücken.
Er hatte sich von seinem hellgrauen, zotteligen Bart verabschiedet. Er hatte die Geheimratsecken frei rasiert, um einen spärlichen Haarwuchs zu suggerieren, obwohl er eigentlich mit seiner Frisur noch ganz zufrieden war. Die Augenbrauen, die im Laufe der Jahre zu einem einzigen grauschwarzen Balken zusammengewachsen waren, hatte er gezupft, sodass sie sich nun als zwei dünne, schmale Striche zeigten. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er Stunden damit verbracht, sich mit seinem Gesicht zu beschäftigen. Am Ende war er sich nicht sicher, ob er sich in einer Menschenmenge noch selbst wiedererkannt hätte.
Den uralten BMW hatte er in einer Kfz-Werkstatt gemietet, die allenfalls als fragwürdig bezeichnet werden konnte. Bezahlt hatte er in bar und ohne irgendeinen Ausweis vorzuzeigen. Niemand, niemand konnte ihn dabei beobachtet haben, niemand konnte wissen, wohin er fuhr. Er war in Sicherheit.
Und trotzdem.
Vielleicht hätte er es ahnen können.
Vielleicht noch nicht, als die Schranke am Bahnübergang ihm die Weiterfahrt versperrte, da vielleicht noch nicht, obwohl ihn die Angst bereits gepackt hatte, als er um die Ecke bog. Als er auf die leuchtende Schranke zufuhr, die plötzlich im Dunklen auftauchte, sich quer über die Fahrbahn legte, und als das klagende Hämmern des Signals in seine Ohren drang.
Er hatte angehalten, stand direkt vor dem roten, blinkenden Auge der Schranke. Ein einsamer Wagen in einer dunklen Nacht. Warten. Eine Minute, vielleicht zwei.
Spätestens da, wenn nicht schon früher. Da hätte er es begreifen müssen.
Als das Signal verstummte, ohne dass ein Zug die Stelle passiert hatte.
Eine erneute Welle des Unbehagens durchströmte ihn: diese plötzliche Stille, als das Signal ausblieb, die Bewegung der Schranke, die sich wie von selbst aufrichtete. Zurück blieben nur der Bahnübergang und er, zwei einsame Individuen in einer stillen Winternacht irgendwo in der südschwedischen Provinz Schonen.
Um ihn herum nur Dunkelheit. Dunkelheit und die weiten Felder auf der anderen Seite der Schienen. Leere Äcker aus steinhartem Lehm, die sich weit erstreckten, bis sie in einem dunklen Nebel am Horizont verschwanden. Hoch oben im Himmel die roten Punkte der Windkraftanlagen, die unsichtbar in der trostlosen Einsamkeit rotierten.
Er hatte sich gezwungen, die aufsteigende Angst abzuschütteln. Es gab keinen Grund dafür. Wahrscheinlich war der Zug schon durchgefahren, bevor er die Schranke erreicht hatte. Oder die Lokomotive hatte einen Defekt und war dadurch zu einem frühzeitigen Halt gezwungen worden. War ja auch egal.
Wichtig war nur, dass er nicht dort stehen blieb. Er befand sich in einem fremden Land und hatte es außerdem eilig. Vor ihm lag eine lange Reise, und er durfte keine Zeit verlieren.
Er startete den Motor.
Langsam rollte er über die Schienen.
Und genau in diesem Moment geschah es. Alles ging mit einem Schlag aus. Alles im Wagen. Die Armatur, die Lampe am Zündschloss, alle Schalter und Knöpfe, alles. Das Abblendlicht, das die Fahrbahn vor ihm beleuchtete. Die Rücklichter, deren hellroter Schein die Heckscheibe umrahmte. Und vor allem – der Motor.
Er drehte den Schlüssel im Zündschloss. Nichts. Ein zweites Mal und ein drittes. Jetzt spring endlich an, verdammt, hörte er sich brüllen, er hämmerte aufs Lenkrad ein, aber das änderte nichts.
Als er den Türgriff packte, hatte er eigentlich schon alles begriffen. Wie sehr er auch daran reißen und zerren würde, die Türen würden fest verschlossen bleiben, und nichts und niemand würde daran etwas ändern können. Dasselbe galt für die Fenster. Wie sehr er auch auf die armen Türknöpfe einschlug, der Wagen blieb verschlossen und dunkel und tot.
Da senkten sich die Schranken wieder, mit dem klagenden Hämmern des Signals.
Da hörte er auch das zischende Geräusch. Und er verstand.
Da war es schon zu spät.
Er hatte sich quer über die vorderen Sitze gelegt, als er die Lichter sah.
Er trat wie besessen mit den Schuhsohlen gegen die Scheibe, sein Blut pochte hinter den Schläfen, er hatte Blutgeschmack im Mund, den Geschmack von Angst und Eisen, obwohl es erst in ein paar Sekunden so weit sein würde.
Er spürte die Vibration der Glasscheibe unter seinen Füßen, aber das hatte keine Konsequenzen. Die Scheibe blieb heil, und die Türen blieben verschlossen. Dann sah er, wie die dreckige Scheibe von den an Strahlkraft zunehmenden Scheinwerfern des Zuges erfasst wurde. Er schloss die Augen, und alles, was er hörte, waren Geräusche.
Das Zischen der Schienen.
Sein Herzschlag im Hals.
Und dann hörte er das Tuten, als der Lokführer den dunklen Wagen auf dem Bahnübergang sah. Ein lautes beharrliches Warnsignal. Das Letzte, was er hörte, war das durchdringende Knirschen von Eisen, das sich in anderes Eisen bohrte, und das Kreischen der Bremsen, obwohl es schon längst zu spät war.
Er dachte vor allem an sein Aussehen.
Nicht, weil er eitel war.
Sondern weil er wusste, dass niemand herausbekommen würde, wer er war.
1. TAG. MONTAG,
3. DEZEMBER.
AMBERLANTZ.
Ich habe keine erste Erinnerung.
Ich erinnere mich an keine Geburt.
Ich erinnere mich an keinen Ort.
Ich weiß nur, dass ich jetzt lebe und dass es hinter mir eine Vergangenheit gibt.
2
Tage, an denen sich das Leben verändert, beginnen wie alle anderen Tage auch.
Es weckt einen niemand morgens und verkündet einem, dass der heutige Tag ein wenig anstrengend werden könnte und man sich darum eine Extrastulle schmieren und den Kaffee besonders lange genießen sollte, weil es nämlich eine ganze Weile dauern könnte, bis man dazu wieder Gelegenheit hat. Niemand legt seinen Arm um deine Schultern und bereitet dich auf das Kommende vor.
Alles ist so wie immer.
So lange, bis es das nicht mehr ist.
Als die Nachmittagsdämmerung sich an diesem Montag über Stockholm senkte, an diesem 3. Dezember, da wusste niemand, dass die nationale Sicherheitsstufe in aller Verschwiegenheit von „Friedenszeit“ auf „erhöhte Gefahr“ geändert worden war.
Niemand wusste, dass in dem großen Backsteingebäude im Stadtteil Gärdet Frauen und Männer in Uniformen saßen und das Schlimmste erwarteten.
Und niemand wusste, dass der große Stromausfall, der um exakt sechs Minuten nach vier eintreten sollte, nur der Anfang von etwas viel Größerem war.
Die Männer in dem weißen Lieferwagen auf dem Klarabergsviadukt hatten keine Ahnung, worauf sie warteten.
Das heißt, sie hatten natürlich eine Ahnung, was geschehen sollte, aber sie wussten nicht, auf wen genau sie warteten. Sie wussten nicht, was er machen würde, wen er treffen würde, wie es im Detail aussehen würde. Und sie wussten nicht, warum sie dort warten sollten, und das machte ihnen am allermeisten Sorgen.
Die Stille in dem engen Lieferwagen war beklemmend. Von außen sah der Wagen aus wie jeder beliebige Transporter, was selbstverständlich beabsichtigt war, vor langer Zeit war er wahrscheinlich einmal angeschafft worden, weil das Modell als geräumig und großzügig gegolten hatte. Die Meinung darüber hatte sich im Laufe der Zeit diametral geändert. Jemand hatte einem Stab von Technikern viel zu freie Hand gelassen und ein viel zu hohes Budget gezahlt, und jetzt war der Wagen so vollgestopft mit Monitoren und technischen Geräten, dass er nicht wie ein Arbeitsplatz, sondern vielmehr wie das kostspielig ausstaffierte Jungenzimmer im Haus einer außerordentlich beengt lebenden Familie aussah.
Der Raum hinter der Fahrerkabine war auf ein Minimum beschnitten und mit Regalen bestückt worden, die mit Rechnern und Elektronik gefüllt waren. Reihenweise Maschinen, die bestimmt etwas Wichtiges ermittelten, aber eigentlich die meiste Zeit nur rot und grün blinkten. An einer der Seitenwände hingen zwei Reihen mit Flachbildschirmen, und an die Arbeitsfläche, die sich unter diesen Monitoren erstreckte, zwängten sich vier Männer – mindestens zwei zu viel. Die beiden, die an den Tastaturen saßen, waren nicht derselbe Jahrgang, aber unglücklicherweise dieselbe Gewichtsklasse wie die beiden, die hinter ihnen standen und das Kommando hatten: Der eine war der, den alle „Lassie“ nannten, sobald er außer Hörweite war, und der andere war der IT-Experte, sehr schweigsam und hoffentlich älter, als er aussah. Sie standen mit gesenkten Köpfen in dem zu niedrigen Innenraum, Schulter an Schulter. Ihre Blicke klebten an den Monitoren.
Der Ältere sah es als Erster.
Zwei Minuten vor der vereinbarten Zeit.
„Was zum Teufel macht er da?“
Seine Stimme war nicht mehr als ein Ausatmen, aber alle hatten ihn gehört, und als sie begriffen, worauf sich seine Äußerung bezog, da konnten sie es ebenfalls sehen.
Vielleicht war es die Art, wie er sich bewegte. Vielleicht die Angestrengtheit seiner Schritte oder etwas ganz anderes. Was auch immer es war, es sorgte dafür, dass eine Welle der Aufmerksamkeit durch den aufgeheizten Raum zog: dieselbe Wachsamkeit, die einen erfasst, wenn man in der Theaterpause im Augenwinkel eine alte Liebe entdeckt, die man schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat, die aber so sehr aus der Menschenmenge heraussticht, dass man seine Augen nicht von ihr lassen kann.
Dort am Rand des Bildausschnitts. Graublauer Mantel über graublauer Kleidung, verschwommene Kontraste, ähnlich der Bildauflösung insgesamt, die übermittelt wurde von den Überwachungskameras. Aber es gab keinen Zweifel. Er war es.
Der Mann zögerte einen kurzen Augenblick vor den Drehtüren am Eingang des Hauptbahnhofs in der Vasagatan. Sah sich um, obwohl er sich gut auskannte, zögerte, bevor er seinen Weg über den graublauen Marmorboden fortsetzte und sich an den anderen graublauen Menschen mit ihren graublauen Reisetaschen vorbeidrängte.
Er hatte sich verändert.
Er rannte nicht, er schlenderte eher. Seine Haare standen in alle Richtungen, als wäre er gerade eben erst aufgestanden, obwohl es schon Nachmittag war. Oder als hätte er dem Wind und der Feuchtigkeit sein Styling überlassen. Er war immer gut angezogen gewesen, scharfzüngig und durchtrainiert, jemand, der bei allen Verwunderung hervorrief, wenn er erzählte, er sei fünfzig geworden – zum wiederholten Mal, ein Witz, der sich bei den vergangenen drei Geburtstagen etabliert hatte. Letztes Mal hat es so viel Spaß gemacht, da dachte ich, ich werde dieses Jahr wieder fünfzig.
Aber in den letzten drei Monaten schien ihn sein wahres Alter eingeholt zu haben. Und nicht nur das: Es sah aus, als hätte ihn sein Alter überholt, als wäre es rechts an ihm vorbeigezogen. Er sah müde aus, gebrochen und alt, seine Jeans klebte schwer von Schnee an seinen Beinen, und als er sich in der Bahnhofshalle umsah, machte er ruckhafte, vogelartige Bewegungen, seine Konzentration wirkte angestrengt, als könnte sie jederzeit in sich zusammenfallen.
Er tauchte auf den Monitoren auf und verschwand gleich wieder, er war auf dem Weg in die gewölbte Haupthalle, lief an den Wandgemälden vorbei und hinüber zu den neuen Rolltreppen, von denen niemand wusste, warum sie besser sein sollten als die alten.
Es konnte unmöglich er sein, auf den sie warteten.
Aber warum war er dann ausgerechnet jetzt dort?
„Was machen wir?“, fragte das Jungengesicht.
„Wir warten ab“, sagte der, der nicht Lassie hieß.
Und das taten sie dann. Zwei lange Minuten lang wurde in dem weißen Lieferwagen kein einziges Wort gesprochen.
Es war nach wie vor erst sieben Minuten vor vier, als das knallgelbe Taxi an der Vasagatan hielt und William Sandberg in den Schneematsch und die Nachmittagsdunkelheit an diesem Montag entließ. Es war der 3. Dezember.
Dicke Schichten aus dunkelgrauen Wolken hingen wie ein tonnenschwerer Topfdeckel an der Stelle, wo eigentlich der Himmel hätte sein sollen. Die Luft war so feucht, dass die Geräusche von Verkehr und Bauarbeiten zu einem einzigen dumpfen Grollen verschmolzen. Überall in den Straßen kämpften die Baustrahler und Straßenlaternen sich mühsam durch die Feuchtigkeit, an alle Fassaden klammerten sich Baugerüste, als hätte jemand die Stadt mit einer gigantischen Zahnspange versehen, in der Hoffnung, dass sie nun richtig weiterwuchs.
Er war müde. Heute so müde wie gestern und wie vorgestern. Wenn er tiefer in sich hineingehört hätte, wäre ihm auch sein Hunger aufgefallen, aber wenn er sich eine Sache nicht zugestand, dann war es dieses In-sich-Hineinhören. Er hatte damit aufgehört, als er begriff, dass seine Gefühle ihn auffraßen, und zwar buchstäblich: auffraßen. Sie fraßen ihn von innen auf, mit großen gierigen Bissen. Von dem ursprünglichen William Sandberg waren mindestens zehn Kilo verschwunden. Diese Diät war noch von keinem Magazin vorgeschlagen worden. Man muss sich nur etwas zulegen, das einem so richtig Sorgen macht.
Er versuchte sich zu konzentrieren. Überquerte den Platz mit großen Schritten und mit so wenig Kontakt wie möglich zu der hauchdünnen Schneedecke, die sich unter seinen Füßen sofort in Wasser verwandelte. Er lief durch die große Haupthalle, in der aus dem Schnee ein spiegelglatter, zimtbrauner Matsch wurde und wo sich der Geruch von Dreck und feuchter Kleidung mit den Gerüchen von superteurem Latte macchiato und dem Atem von Zigtausenden Menschen mischte, die auf dem Heimweg waren.
Aber all das bemerkte William Sandberg nicht. Er nahm weder die Gerüche wahr noch die Hitze auf seinem Gesicht, als der eisige Wind von der Wärme im Inneren des Gebäudes ersetzt wurde, auch nicht die genervten Ellenbogen, die ihn erwischten, als er sich zwischen den Menschen auf seinem Weg zum nördlichen Ausgang hindurchzwängte.
Knapp zwei Wochen waren seit der ersten Mail vergangen, und in exakt sieben Minuten sollte er am Gleis vom Flughafenexpress sein.
Exakt, so hatte es in der Mail geheißen.
Das Einzige, was er empfand, war Hoffnung.
Hoffnung und die Angst, die damit einherging.
Er hatte bereits fünf Minuten am Ticketautomaten gestanden, als er begriff, dass er nach der falschen Sache gesucht hatte.
Das Gleis war voller Geschäftsreisender gewesen, die ihre Rollkoffer hinter sich herzogen, Menschen mit leeren Blicken, die tief in ihrem Inneren überwinterten und auf einen Zug warteten, der sie an einen Ort bringen würde, an dem sie auch wieder nicht sein wollten. William hatte nach denen Ausschau gehalten, die eben nicht gesehen werden wollten. Menschen in schmuddeligen Jacken, die schwere, prall gefüllte Plastiktüten herumschleppten und sich mehrere Lagen Schals um den Hals gewickelt hatten, darüber rastlose frierende Augen. Menschen, die sich unter ihrer ausgebeulten Kleidung versteckten, dicke Schutzschichten trugen gegen die Kälte und gegen den Kontakt zum Rest der Welt.
William Sandberg hatte auf diese Menschen gehofft.
Er hatte gehofft, dass vielleicht einer von denen sich bei ihm gemeldet hätte. Jemand, der etwas zu erzählen hatte, der mit ihm Kontakt aufgenommen hatte, um ihm den Weg zu weisen, ihm eine Adresse zu geben oder irgendetwas.
Hätte er nicht auf diese Menschen gesetzt, wäre ihm der Mann auf dem anderen Gleis schon viel früher aufgefallen.
Er war ein gutes Stück über dreißig, vielleicht sogar schon in den Vierzigern. In einem Ohr ein Headset, der Blick scheinbar geistesabwesend und die Kleidung so bemüht durchschnittlich, dass er, wenn man ihn erst einmal wahrgenommen hatte, aus der Menge herausstach wie ein Kind, das sich hinter einer Gardine versteckte.
Sein Anzug war mattgrau, und darüber trug er eine No-Name-Jacke, die so sorgfältig zugeknöpft war, dass sein Sakko darunter wie ein plissiertes Kleid hervorschaute. Am Ende seiner Anzughose steckten zwei farblose Sneaker. Zusammengefasst schrie diese ganze Aufmachung so lauthals diskret! wie nur möglich – weshalb in gewisser Weise also das genaue Gegenteil dabei herauskam.
Aber was William überzeugte, war das Telefonat, das der Mann führte.
Es schien mehr aus Schweigen denn aus Konversation zu bestehen. Minutenlang hing das Kabel nutzlos vom Ohr des Mannes herunter. Dreimal ertappte sich William bei dem Gedanken, dass er eventuell einen altmodischen Radiosender eingestellt hatte, auf Mono. Und jedes Mal sah er dann, wie der Mund des Mannes sich öffnete und kurze abgehackte Sätze formulierte. Das war alles. Ansonsten stand er unruhig wartend da, legte den Kopf von einer auf die andere Seite, so, als würde er ins Leere sehen. Aber seine Augen erfassten ohne Zweifel jede kleine Regung um ihn herum.
Langsam spürte William, wie eine Bereitschaft in seinem Körper erwachte.
War es ein Fehler gewesen hierherzukommen?
Ehrlich gesagt, wusste er nicht genau, warum er gekommen war. Er hatte mehrere Warnsignale erkannt, sich aber bewusst dafür entschieden, ihnen kein Gehör zu schenken. Er hatte seinem Wunschdenken die Regie überlassen, und darum war er gekommen. Unvorbereitet und vollkommen schutzlos. Vielleicht war er in etwas hineingeraten, das er noch gar nicht überblicken konnte.
Oder aber er war nur ein misstrauischer alter Idiot und sollte sich mal entspannen. Es war weder verboten, einen schlechten Kleidungsstil zu haben, noch war es verboten zu telefonieren, obwohl man beide Verbote vielleicht ernsthaft hätte diskutieren können. William war zu einem geheimen Treffen beordert worden, und ganz offensichtlich hatte sich die Person verspätet. Was war daran besonders auffällig oder sonderbar?
Als der Flughafenexpress in den Bahnhof einrollte, wurde ihm klar, dass er seiner ersten Intuition hätte Glauben schenken sollen.
Der Zug hielt mit seinen tonnenschweren und kreischgelben Wagen am Gleis, zischend und tropfend, während die Reisenden sich aneinander vorbeizwängten, um aus- oder einzusteigen. Zaghaft bildeten sich mehrere Ströme von kleineren Volkswanderungen, die sich in die verschiedensten Richtungen bewegten, mit dem Ziel, ins Hauptgebäude, zu den Taxiständen oder zu einem der anderen Gleise zu gelangen. Und gleichermaßen zaghaft wurde offenkundig, das einige nicht auf dem Weg zu einem neuen Ziel waren.
Zum einen der sehr diskrete Mann mit dem Headset.
Zum anderen aber noch ein weiterer Mann.
Er stand auf derselben Gleisseite wie William, am hinteren Ende. Auch er trug ein Headset im Ohr, auch er war überdeutlich diskret gekleidet und führte offenbar eine ganz ähnliche Unterhaltung. Kurze abgehackte Sätze.
Und wenn man es sich genauer ansah, gab es auch keinen Zweifel mehr.
Sie unterhielten sich miteinander.
Seine Müdigkeit war schlagartig wie weggeblasen. Irgendetwas stimmte hier nicht. William hatte genaue Anweisungen erhalten, sich exakt um vier Uhr einzufinden. Das Wort exakt irritierte ihn, zumal es jetzt fünf Minuten nach vier war und niemand aufgetaucht war. Niemand außer diesen beiden Männern.
Die auf dieselbe Person warteten wie er?
Oder schlimmer noch: die auf ihn warteten?
In diesem Augenblick wurde ihm klar, dass er denselben Fehler beging wie die beiden. Das Gleis hatte sich zunehmend geleert, wer nicht in den Zug einstieg, der war gerade ausgestiegen und hatte sich zu seinem Ziel aufgemacht. Verdammt. William waren diese beiden Männer ja nur deshalb aufgefallen, weil sie dort standen, wo sie eben standen. Und er verhielt sich jetzt exakt genauso.
Er zögerte nicht länger als zwei Sekunden, dann hatte er einen Entschluss gefasst.
Treffen oder nicht, von seiner Seite aus war die Aktion jetzt abgeblasen. Er wandte sich zum Gehen, mischte sich unter den Strom der Reisenden, die ins Hauptgebäude wollten.
Er kam nur einen Schritt weit.
„Amberlantz?“
Der Mann versperrte William den Weg und hatte einen so beeindruckenden Brustkorb, dass es in jeder anderen Situation zum Brüllen komisch gewesen wäre. Aber jetzt hatte es nur etwas sehr Beunruhigendes. Und er war viel zu dicht bei ihm. Er war mit dem dritten Exemplar des diskreten Anzuges ausgestattet – vielleicht hatten sie einen Mengenrabatt bekommen – und stand breitbeinig und massiv vor ihm. Die Arme hingen wie in Bereitschaft an seinem Körper herunter. Aber bereit für was?
„Und Sie sind?“, fragte William.
Er biss sich in Gedanken auf die Zunge. Hätte er nicht vielmehr so tun müssen, als wüsste er von nichts? Natürlich hätte er das tun sollen.
„Ganz ruhig bleiben“, antwortete der Mann anstatt einer Antwort. Nordschwedischer Dialekt, ein kalter und präziser Befehl, und doch hatte er eine Nuance gehört. War es Angst? „Folgen Sie uns, dann passiert auch nichts.“
Uns?
„Wenn Sie andeuten, dass mir nichts passieren wird“, entgegnete William, um Zeit zu gewinnen, „könnten Sie präzisieren, was es denn sein wird, das mir nicht passiert?“
Der Nordschwede hob mit einer leichten Geste die Seite seines Mantels an.
Und mehr Information benötigte William nicht.
Später konnte er nicht mehr rekonstruieren, was ihn zu seiner Entscheidung bewogen hatte. Die Waffe war es eigentlich nicht gewesen. Was da unter dem Sakko in einem schwarzen Nylonholster steckte und seiner Meinung nach eine Sig Sauer sein musste, war zum einen die gewöhnlichste Dienstwaffe der schwedischen Polizei, zum anderen auch beunruhigend häufig in der Unterwelt vertreten.
Aber sie war nicht der Auslöser. Auch nicht das Headset. Das William in seinem Misstrauen bestärkte, dass dieser Mann zu den beiden anderen gehörte und er keine Chance hatte zu entkommen. Nein, auch das hatte ihn nicht zur Flucht bewogen.
Es war der Zufall, der alles entschied.
Der Zufall, das Timing und die Dunkelheit.
Tage, an denen sich das Leben verändert, beginnen wie alle anderen Tage auch.
Alles ist wie immer, bis es das nicht mehr ist.
Als sechs Minuten nach vier durch einen totalen Stromausfall in großen Teilen Schwedens plötzlich tiefschwarze Dunkelheit herrschte, war es noch ein Tag wie jeder andere. Ein feuchtkalter Nachmittag in einem jahreszeitlichen Grenzland, das weder Herbst noch Winter sein wollte.
Im Stockholmer Hauptbahnhof verschwand alles Licht, die Loks verloren an Kraft und versanken in tiefe Stille, Monitore und Anzeigetafeln erloschen.
In den Krankenhäusern und auf dem Flughafen sprangen sofort die Notstromaggregate an, aber auf den Straßen, in den Tunneln und auf den Eisenbahntrassen gingen die Lampen und Lichter aus und sorgten für Stau und Verwirrung.
Das war nervig und unpraktisch und ein verdammter Skandal. Man muss sich nur einmal vorstellen, wie es ist, stundenlang mitten auf der Bahntrasse stecken zu bleiben oder in einem Aufzug. In was für einem Land leben wir eigentlich?
Aber für die meisten war das auch schon alles.
Nicht für William Sandberg.
Für ihn war das der Anfang des Abends, an dem sein Leben seinen Sinn verlor.
Für den Mann in dem weißen Lieferwagen auf dem Klarabergsviadukt war es die Bestätigung dessen, dass die Sache im Begriff war, sich unkontrolliert auszuweiten.
„Ein Buch, das man nicht aus der Hand legen kann.“
„Nach seinem Debüt ›Der Code‹ liefert der schwedische Autor Olsson mit ›Das Netz‹ erneut einen packenden, gut ausgearbeiteten Thriller ab.“
„Olssons spannender Thriller fesselt den Leser nicht nur. Die Vision, die er zeichnet, macht auch betroffen und nachdenklich.“
„Olsson baut seine Story intelligent auf und erzählt sie souverän spannend.“





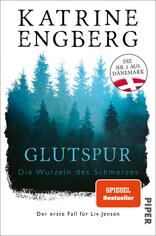

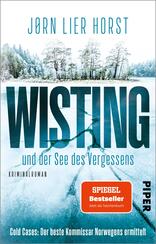




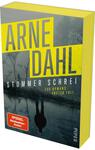
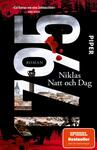
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.