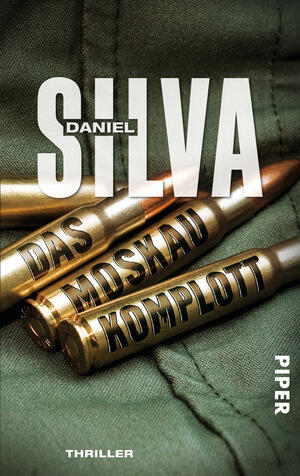
Das Moskau-Komplott (Gabriel-Allon-Reihe 8)
Thriller
„Perfekte Unterhaltungsliteratur zum In-einem-Rutsch-Lesen.“ - Neue Presse
Das Moskau-Komplott (Gabriel-Allon-Reihe 8) — Inhalt
Der Mord an einem russischen Journalisten. Ein obskurer Milliardär namens Charkow. Die schmutzigen Geschäfte des neuen Russland. Und ein gefälschtes Gemälde, das Geheimagent und Kunstrestaurator Gabriel Allon auf die Spur eines Waffendeals ungeahnten Ausmaßes führt. Brisant und stark: der 8. Fall der Gabriel-Allon-Reihe von Daniel Silva.
Leseprobe zu „Das Moskau-Komplott (Gabriel-Allon-Reihe 8)“
Teil I
Der Ruf
1
Courchevel, Frankreich
Die Invasion begann wie jedes Jahr in den letzten Dezembertagen. Sie kamen in einer Karawane gepanzerter Luxuslimousinen die gewundene Straße aus dem Rhône-Tal herauf oder landeten mit dem Hubschrauber oder Privatflugzeug auf dem tückischen Bergflughafen mit seiner kurzen Start- und Landebahn. Milliardäre und Banker, Öltycoons und Metallmagnaten, Supermodels und verwöhnte Kinder: die Geldelite des wieder erstarkenden Russlands. Sie strömten in die Suiten des Cheval Blanc und Byblos und okkupierten die großen [...]
Teil I
Der Ruf
1
Courchevel, Frankreich
Die Invasion begann wie jedes Jahr in den letzten Dezembertagen. Sie kamen in einer Karawane gepanzerter Luxuslimousinen die gewundene Straße aus dem Rhône-Tal herauf oder landeten mit dem Hubschrauber oder Privatflugzeug auf dem tückischen Bergflughafen mit seiner kurzen Start- und Landebahn. Milliardäre und Banker, Öltycoons und Metallmagnaten, Supermodels und verwöhnte Kinder: die Geldelite des wieder erstarkenden Russlands. Sie strömten in die Suiten des Cheval Blanc und Byblos und okkupierten die großen Privatchalets an der Rue de Bellecôte. Sie buchten den Club Les Caves für nächtelange Privatpartys und plünderten die Nobelboutiquen an der Croisette. Sie nahmen alle guten Skilehrer in Beschlag und kauften in den Weinhandlungen die besten Champagner und Cognacs auf. Am Morgen des Achtundzwanzigsten war in der Stadt kein Friseurtermin mehr zu bekommen, und im Chalet de Pierres, dem für sein über offener Flamme gegrilltes Rindfleisch bekannten Bergrestaurant, war bis Mitte Januar für den Abend kein Tisch mehr zu haben. Am Silvesterabend war die Invasion abgeschlossen. Courchevel, der exklusive Skiort in den französischen Alpen, war wieder fest in russischer Hand.
Nur das Grandhotel Courchevel stemmte sich erfolgreich gegen den Ansturm aus dem Osten. Und nicht von ungefähr, wie eingefleischte Stammgäste wussten, denn im Grandhotel wurden Russen, wie auch Familien mit Kindern, diskret aufgefordert, sich woanders eine Unterkunft zu suchen. Es verfügte über dreißig Zimmer von bescheidener Größe und dezenter Ausstattung. Niemand kam wegen goldener Wasserhähne oder tennisplatzgroßer Suiten hierher. Man kam, um ein wenig altes Europa zu schnuppern. Man kam, um es sich in der Lounge Bar mit einem Campari gemütlich zu machen oder im Frühstückszimmer bei einem Kaffee in aller Ruhe Le Monde zu lesen. Die Herren trugen bei Tisch Jacketts und warteten bis nach dem Frühstück, ehe sie sich in ihre Skimontur warfen. Unterhaltungen wurden in gedämpftem Ton und mit ausgesuchter Höflichkeit geführt. Das Internet hatte im Grandhotel noch nicht Einzug gehalten, und die Telefone hatten ihre Macken. Die Gäste
schien das nicht zu stören. Sie waren so vornehm wie das Hotel selbst und im Durchschnitt schon über das mittlere Alter hinaus. Ein Witzbold aus einem der schickeren Luxushotels im Jardin Alpin titulierte die Klientel des Grandhotels einmal als „Senioren und ihre Eltern“. Die kleine Lobby war sauber und mit einem gut unterhaltenen Holzfeuer beheizt. Zur Rechten, nahe dem Eingang zum Speisezimmer, war die Rezeption, eine beengte Nische mit Messinghaken für die Zimmerschlüssel und Fächern für Post und Nachrichten. Neben der Rezeption und unweit des schnaufenden – und einzigen – Lifts stand der Conciergetisch. Am frühen Nachmittag des zweiten Januar war er von Philippe besetzt, einem gut gebauten ehemaligen französischen Fallschirmjäger, der die gekreuzten goldenen Schlüssel des International Concierge Institute auf seinem makellosen Revers trug und davon träumte, dem Hotelgewerbe eines Tages endgültig den Rücken zu kehren und sich dauerhaft auf der Trüffelfarm seiner Familie im PØrigord niederzulassen. Der nachdenkliche Blick seiner dunklen Augen senkte sich auf die Liste der bevorstehenden Ankünfte und Abreisen. Sie bestand nur aus einem einzigen Eintrag: Lubin, Alex. Anreise mit dem Wagen aus Genf. Reservierung für Zimmer 237. Skimiete erforderlich. Philippe richtete sein erfahrenes Conciergeauge auf den Namen. Er hatte ein feines Gespür für Namen. Das brauchte man in seinem Beruf. Alex…Kurzform von Alexander, vermutete er. Oder war es Aleksandr? Oder Aleksej? Er schaute auf und räusperte sich diskret. Ein tadellos frisierter Kopf wurde aus der Rezeption gesteckt. Er gehörte Ricardo, dem Empfangschef am heutigen Nachmittag. „Ich glaube, wir haben ein Problem“, sagte Philippe ruhig. Ricardo runzelte die Stirn. Er war Spanier aus dem Baskenland. Er mochte Probleme nicht sonderlich. „Inwiefern?“ Philippe hielt das Blatt mit den Ankünften hoch. „Lubin,
Alex.“ Ricardo drückte mit einem manikürten Zeigefinger ein paar Tasten seines Computers. „Zwölf Übernachtungen? Skimiete erforderlich? Wer hat die Reservierung entgegengenommen?“ „Ich glaube, das war Nadine.“ Nadine war die Neue. Sie arbeitete zurzeit in der Nachtschicht. Und für das Vergehen, einem Mann namens Alex Lubin ein Zimmer zu reservieren, ohne das vorher mit Ricardo abzustimmen, würde sie dies bis in alle Ewigkeit tun. „Sie glauben, er ist Russe?“, fragte Ricardo. „Schuldig im Sinne der Anklage.“ Ricardo erhob keinen Einspruch. Obwohl Philippes Vorgesetzter, war er zwanzig Jahre jünger und hatte gelernt, sich auf die Erfahrung und das Urteil des Älteren zu verlassen. „Vielleicht können wir ihn der Konkurrenz unterjubeln.“
„Ausgeschlossen. Zwischen hier und Albertville ist kein Zimmer mehr frei.“ „Dann haben wir ihn wohl am Hals – es sei denn, er lässt sich dazu überreden, von allein wieder zu gehen.“ „Was schlagen Sie vor?“ „Plan B natürlich.“ „Das ist ziemlich extrem, finden Sie nicht?“ „Schon, aber es ist der einzigeWeg.“ Der Ex-Fallschirmjäger nahm den Befehl mit einem knappen Nicken entgegen und machte sich an die Planung des Unternehmens. Es begann um 16.12 Uhr, als ein dunkelgrauer Mercedes mit Genfer Kennzeichen an der Vordertreppe vorfuhr und hupte. Philippe verharrte volle zwei Minuten an seinem Pult, bevor er in aller Gemächlichkeit seinen Wintermantel überzog und sich verhaltenen Schrittes nach draußen begab. Der unerwünschte Monsieur Alex Lubin – zwölf Nächte, Skimiete erforderlich – war unterdessen aus seinem Wagen gestiegen und stand nun ungehalten neben dem offenen Kofferraum. Er hatte ein scharfkantiges Gesicht und hellblondes Haar, das sorgfältig über einen breiten Schädel drapiert war. Seine zusammengekniffenen Augen waren auf den Kofferraum gerichtet, in dem zwei große Nylonkoffer lagen. Bei ihrem Anblick runzelte der Concierge die Stirn, als hätte er solche Objekte noch nie im Leben gesehen, dann begrüßte er den Gast mit eisiger Wärme. „Kann ich Ihnen behilflich sein, Monsieur?“ Die Frage war auf Englisch gestellt worden. Die Antwort erfolgte in derselben Sprache, allerdings mit deutlich slawischem Akzent. „Ich checke im Hotel ein.“ „Tatsächlich? Man hat mich gar nicht davon unterrichtet, dass heute Nachmittag ein Gast erwartet wird. Bestimmt nur ein kleines Versehen. Sprechen Sie doch bitte mit meinem Kollegen an der Rezeption. Ich bin sicher, er wird das Missverständnis aufklären können.“ Lubin brummte etwas vor sich hin und stapfte die steile Treppe hinauf. Philippe griff nach dem ersten Koffer und hängte sich bei dem Versuch, ihn herauszuwuchten, fast das Kreuz aus. Der Russe ist Vertreter für Ambosse und hat seinen Musterkoffer mitgebracht. Später, als er die beiden Gepäckstücke erfolgreich in die Eingangshalle verfrachtet hatte, war Lubin gerade dabei, einem verdutzt dreinschauenden Ricardo, dem es trotz aller Bemühungen nicht gelingenwollte, die fragliche Reservierung zu finden, ganz langsam seine Reservierungsnummer zu diktieren. Schließlich wurde das Problem gelöst – „Ein kleiner Irrtum einer Mitarbeiterin, Monsieur Lubin. Ich werde ein Wort mit ihr reden müssen “ –, nur um dem nächsten Platz zu machen. Durch ein Versehen des Etagenpersonals war das Zimmer noch nicht bezugsfertig. „Es dauert nur einen Moment“, sagte Ricardo mit seiner samtigsten Stimme. „Mein Kollege wird Ihre Koffer in den Abstellraum bringen. Wenn ich Sie solange in unsere Lounge Bar bitten dürfte. Die Getränke gehen selbstverständlich aufs Haus.“ Selbstverständlich gingen sie nicht aufs Haus, sondern wurden in Rechnung gestellt, und zwar saftig, aber damit wollte Ricardo Monsieur Lubin erst überraschen, wenn seinWiderstand erlahmt war. Bedauerlicherweise erwies sich Ricardos Zuversicht, dass die Verzögerung nur von kurzer Dauer sein würde, als unangebracht, und es vergingen weitere neunzig Minuten, ehe Lubin, ohne Gepäck, in sein Zimmer geführt werden konnte. Gemäß Plan B fehlte ein Bademantel für Ausflüge ins Wellness-Center, der Wodka in der Minibar und die Fernbedienung für den Fernseher. Der Wecker auf dem Nachttisch war auf 4.15 Uhr gestellt. Die Heizung bullerte. Philippe entfernte heimlich das letzte Stück Seife aus dem Badezimmer, dann schlüpfte er, nachdem ihm ein Trinkgeld versagt worden war, mit dem Versprechen zur Tür hinaus, dass die Koffer in Kürze gebracht würden. Ricardo erwartete ihn bereits, als er dem Lift entstieg. „Wie vieleWodkas hat er in der Bar getrunken?“ „Sieben“, antwortete Ricardo. Der Concierge biss die Zähne zusammen und zischte verächtlich. Nur ein Russe konnte in anderthalb Stunden siebenWodkas trinken und sich noch auf den Beinen halten. „Was glauben Sie?“, fragte Ricardo. „Gangster, Spion oder Killer?“ Das spielte keine Rolle, dachte Philippe finster. Ein Russe hatte die Mauern des Grandhotels durchbrochen. Jetzt war Widerstand das Gebot der Stunde. Sie kehrten auf ihre jeweiligen Außenposten zurück, Ricardo in seine Rezeptionsgrotte, Philippe an sein Pult in der Nähe des Lifts. Zehn Minuten später kam der erste Anruf aus Zimmer 237. Ricardo musste eine stalinistische Tirade über sich ergehen lassen, ehe er ein paar beschwichtigende Worte murmelte und den Hörer auflegte. Er sah Philippe an und grinste. „Monsieur Lubin fragt, wo seine Koffer bleiben.“ „Ich werde mich sofort darum kümmern“, sagte Philippe und unterdrückte ein Gähnen. „Außerdem fragt er, ob etwas gegen die Hitze im Zimmer unternommen werden könnte. Er sagt, es sei zu warm und der Thermostat scheine nicht zu funktionieren.“ Philippe griff zum Telefon und wählte die Nummer der Haustechnik. „Dreht die Heizung in Zimmer 237 wärmer“, sagte er. „Monsieur Lubin friert.“
Hätten sie die ersten Augenblicke von Lubins Aufenthalt miterlebt, hätte sich ihr Verdacht bestätigt, dass ein Bösewicht in ihrer Mitte weile.Wie sonst ließ sich erklären, dass er alle Schubladen aus der Kommode und den Nachttischen riss und sämtliche Glühbirnen aus Lampen und Leuchten schraubte? Das luxuriöse Queensize-Doppelbett komplett abzog und die Schale der Telefonanlage abschraubte? Eine Gratisflasche Mineralwasser in die Toilette goss und zwei Pralinen des Genfer Schokoladenherstellers Touvier auf die verschneite Straße hinauswarf? Und, nachdem er sich ausgetobt hatte, das Zimmer weitgehend wieder in den Zustand zurückversetzte, in dem er es vorgefunden hatte? Der Grund, warum er zu diesen ziemlich drastischen Maßnahmen griff, war sein Beruf, aber sein Beruf war keiner von denen, die Ricardo, der Empfangschef, vermutete. Aleksandr Viktorowitsch Lubin war weder Gangster noch Spion, und er war auch kein Killer. Er übte lediglich den gefährlichsten Beruf aus, den man im schönen neuen Russland ergreifen konnte. Er war Journalist. Und nicht irgendein Journalist, sondern ein unabhängiger Journalist. Seine Zeitschrift, die Moskowskaja Gaseta, gehörte zu den letzten investigativen Wochenmagazinen des Landes und war dem Kreml ein ständiger Dorn im Auge. Seine Reporter und Fotografen wurden permanent beschattet und eingeschüchtert, und nicht nur von der Geheimpolizei, sondern auch von den privaten Sicherheitsdiensten der mächtigen Oligarchen, über die sie zu berichten versuchten. In Courchevel wimmelte es jetzt von solchen Männern. Männer, die nichts dabei fanden, in Hotelzimmern Wanzen verstecken oder Gift versprühen zu lassen. Männer, die nach Stalins Grundsatz verfuhren: Der Tod löst alle Probleme. Kein Mensch, kein Problem. Überzeugt, dass sich niemand im Zimmer zu schaffen gemacht hatte, rief Lubin erneut beim Concierge an, um sich nach seinen Koffern zu erkundigen, und erhielt den Bescheid, dass sie „in Kürze“ eintreffen würden. Darauf setzte er sich, nachdem er die Balkontür aufgerissen hatte, um kalte Abendluft hereinzulassen, an den Schreibtisch und zog einen Aktendeckel aus seiner abgewetzten Ledermappe. Er hatte ihn am Abend zuvor von Boris Ostrowskij, dem Chefredakteur der Gaseta, erhalten. Ihr Treffen hatte nicht in den Redaktionsräumen der Gaseta, die vermutlich gründlich verwanzt waren, stattgefunden, sondern auf einer Bank in der Metrostation Arbatskaja. Ich werde Sie nicht in alle Hintergründe einweihen, hatte Ostrowskij gesagt und ihm mit routinierter Gelassenheit die Unterlagen gereicht. Das ist nur zu Ihrem eigenen Schutz. Verstehen Sie, Aleksandr? Lubin hatte vollkommen verstanden. Ostrowskij erteilte ihm einen Auftrag, der ihn das Leben kosten konnte. Jetzt schlug er den Aktendeckel auf und betrachtete das Foto, das zuoberst auf dem Dossier lag. Es zeigte einen gut gekleideten Mann mit kurz geschnittenen, dunklen Haaren und dem derben Gesicht eines Preisboxers, der bei einem Empfang im Kreml neben dem russischen Präsidenten stand. An das Foto angeheftet war eine Kurzbiografie – überflüssigerweise, denn wie jeder Journalist in Moskau kannte Aleksandr Lubin die Eckdaten von Iwan Borisowitsch Charkows bemerkenswerter Karriere auswendig. Sohn eines hohen KGB-Offiziers…Absolvent der renommierten Moskauer Staatsuniversität…Wunderknabe der Fünften Hauptverwaltung des KGB… Beim Zusammenbruch des Sowjetreichs hatte Charkow den KGB verlassen und in den anarchischen frühen Jahren des russischen Kapitalismus mit Bankgeschäften ein Vermögen gemacht. Er hatte klug in Energie, Rohstoffe und Immobilien investiert, und an der Schwelle zum neuen Jahrtausend zählte er zur wachsenden Riege frischgebackener Moskauer Multimillionäre. Zu den vielen Unternehmen, an denen er beteiligt war, gehörte eine Schifffahrts- und Luftfrachtgesellschaft, deren Tentakel über den Nahen und Mittleren Osten hinaus bis nach Afrika und Asien reichten. Die wahre Größe seines Finanz- imperiums war für Außenstehende unmöglich abzuschätzen. Als relativer Neuling auf dem kapitalistischen Parkett hatte es Iwan Charkow in der Kunst, mit Tarn- und Briefkastenfirmen zu operieren, zu wahrer Meisterschaft gebracht. Lubin schlug die nächste Seite des Dossiers auf. Ein Foto wie aus einem Hochglanzmagazin von „Château Charkow“, IwansWinterpalais an der Rue de Nogentil in Courchevel. Er verbringt dort den Winterurlaub wie jeder andere reiche und prominente Russe, hatte Ostrowskij gesagt. Vorsicht in der Nähe des Hauses. Iwans Gorillas sind lauter ehemalige Speznas- und OMON-Angehörige. Hören Sie, was ich Ihnen sage, Aleksandr? Ich möchte nicht, dass Sie wie Irina Tschernowa enden. Irina Tschernowa war die berühmte Journalistin vom wichtigsten Konkurrenzblatt der Gaseta, die eine von Charkows dubioseren Investitionen aufgedeckt hatte und nur zwei Tage nach Erscheinen ihres Artikels abends im Aufzug ihres Moskauer Wohnhauses von zwei Auftragskillern erschossen worden war. Aus Gründen, die nur ihm bekannt waren, hatte Ostrowskij dem Dossier ein Foto ihrer kugeldurchsiebten Leiche beigelegt. Damals wie heute drehte Lubin es schnell um. Iwan arbeitet gewöhnlich hinter verschlossenen Türen. Courchevel ist einer der wenigen Orte, wo er sich in der Öffentlichkeit bewegt. Wir möchten, dass Sie ihm folgen, Aleksandr. Wir möchten wissen, mit wem er sich trifft. Mit wem er Ski fährt. Wen er zum Essen einlädt. Machen Sie Fotos, wann immer möglich, aber sprechen Sie ihn keinesfalls an. Und sagen Sie niemandem in dem Ort, was Sie beruflich machen. Iwans Sicherheitsleute riechen einen Reporter zehn Meilen gegen den Wind. Ostrowskij hatte ihm daraufhin einen Umschlag überreicht, der Flugtickets, eine Mietwagenreservierung und eine Hotelbuchung enthielt. Melden Sie sich alle paar Tage in der Redaktion, hatte er gesagt. Und versuchen Sie, sich etwas zu amüsieren, Aleksandr. Ihre Kollegen sind alle sehr neidisch. Sie fahren nach Courchevel und feiern mit den Reichen und Berühmten, und wir frieren uns in Moskau den Hintern ab. Nach dieser Bemerkung war Ostrowskij aufgestanden und an die Bahnsteigkante getreten. Lubin hatte das Dossier in seine Ledermappe gesteckt und ihm war sogleich der Schweiß ausgebrochen. Und jetzt schwitzte er wieder. Diese verfluchte Hitze! Die Heizung lief immer noch auf Hochtouren. Er wollte gerade zum Telefon greifen, um sich noch einmal zu beschweren, als es klopfte. Endlich. Mit zwei Schritten durchmaß er den kurzen Eingangsflur und riss die Tür auf, ohne vorher zu fragen, wer da war. Ein Fehler, wie er sofort begriff. Auf dem halbdunklen Korridor stand ein mittelgroßer Mann mit dunklem Skianorak, Wollmütze und verspiegelter Skibrille. Lubin fragte sich noch, wieso jemand abends im Hotel eine Skibrille trug, als ihn der erste Schlag traf, ein brutaler Handkantenhieb gegen den Kehlkopf, der ihm die Luft nahm. Dann folgte ein wohlgezielter Tritt in den Unterleib, der ihn in der Hüfte einknicken ließ. Er brachte keinen Laut heraus, als der Mann ins Zimmer schlüpfte und geräuschlos die Tür hinter sich schloss. Und er war zu keinerlei Widerstand fähig, als der Mann ihn aufs Bett stieß und sich rittlings auf seine Hüften setzte. Das Messer, das er aus seiner Skijacke zog, war eines, das von Elitesoldaten benutzt wird. Es drang direkt unterhalb der Rippen in Lubins Bauch ein und bohrte sich nach oben in Richtung Herz. Während sich seine Brusthöhle mit Blut füllte, musste er eine zusätzliche Demütigung hinnehmen und in den verspiegelten Brillengläsern des Mörders sein eigenes Sterben mit ansehen. Aleksandr Lubin fühlte sein Herz ein letztes Mal schlagen, als sein Mörder lautlos aus dem Zimmer schlich. Die Hitze, dachte er. Diese verfluchte Hitze…
Es war kurz nach sieben, als Philippe endlich Monsieur Lubins Koffer aus dem Abstellraum holte und in den Lift stellte. Als er an Zimmer 237 ankam, hing das Schild BITTE NICHT STÖREN am Türgriff. Gemäß den Vorgaben von Plan B klopfte er dreimal donnernd an. Da er keine Antwort erhielt, zog er seinen Hauptschlüssel aus der Tasche und trat ein, gerade soweit, dass er zwei russische Halbschuhe Größe sechsundvierzig ein paar Zentimeter über das Bettende hinausragen sah. Er stellte die Koffer in den Eingangsflur und kehrte in die Lobby zurück, wo er Ricardo von seiner Beobachtung berichtete. „Stockbesoffen.“ Der Spanier blickte auf die Uhr. „Das ist früh, selbst für einen Russen.“ „Wir lassen ihn seinen Rausch ausschlafen. Morgen früh, wenn er einen ordentlichen Kater hat, gehen wir zu Phase zwei über.“ Der Spanier grinste. Bislang hatte noch kein Gast Phase zwei überstanden. Phase zwei endete immer verheerend.
2
Umbrien, Italien
Die Villa dei Fiori, ein dreihundert Hektar großes Gut in den welligen Hügeln zwischen den Flüssen Tiber und Nera, war schon seit jenen Tagen, als Umbrien noch von den Päpsten regiert wurde, im Besitz der Familie Gasparri. Das Gut beherbergte eine große, einträgliche Rinderzucht, ein Gestüt, in dem die besten Springpferde von ganz Italien gezüchtet wurden, Schweine, die niemand schlachtete, und eine Herde Ziegen, die nur ihres Unterhaltungswerts wegen gehalten wurden. Es besaß kakifarbene Heuwiesen, mit leuchtenden Sonnenblumenfeldern bedeckte Hänge, Olivenhaine, die das beste Öl Umbriens produzierten, und einen kleinen Weinberg, der jedes Jahr ein paar Zentner Trauben zur Ausbeute der örtlichen Genossenschaft beisteuerte. Am höchsten Punkt des Besitzes befand sich ein unbewirtschaftetes Waldstück, das angriffslustige Wildschweine für Spaziergänger unsicher machten. Überall auf dem Gut verstreut standen Madonnenschreine, und an der Kreuzung dreier staubiger Schotterstraßen erhob sich ein imposantes geschnitztes Kruzifix. Überall waren Hunde: ein Quartett durchstreifte Wiesen und Weiden und fraß Füchse und Kaninchen, und ein Paar neurotischer Terrier patrouillierte mit dem Eifer heiliger Krieger um die Ställe. Die Villa selbst lag am Südrand des Guts und war über eine lange, von riesigen Schirmkiefern gesäumte Schotterzufahrt zu erreichen. Im elften Jahrhundert hatte hier ein Kloster gestanden. Davon geblieben waren eine kleine Ka- pelle und, im umfriedeten Innenhof, die Überreste eines Ofens, in dem die Mönche ihr täglich Brot gebacken hatten. Die Türen zum Hof waren aus dicken Bohlen gezimmert und mit Eisen beschlagen und machten den Eindruck, als sollten sie dem Ansturm der Heiden widerstehen. Hinter dem Haus befand sich ein großer Swimmingpool, und an den Pool grenzte ein Garten mit Pergola, an dessen etruskischen Mauern Rosmarin und Lavendel wuchsen. Graf Gasparri, ein nicht mehr ganz junger italienischer Adliger mit engen Verbindungen zum Vatikan, vermietete die Villa nicht, noch hatte er die Gewohnheit, sie Freunden oder Verwandten zur Verfügung zu stellen. Umso überraschter waren die Bediensteten, als sie erfuhren, dass sie einen Langzeitgast aufnehmen sollten. „Sein Name ist Alessio Vianelli“, informierte der Graf Margherita, die Hauswirtschafterin, telefonisch von Rom aus. „Er arbeitet an einem besonderen Projekt für den Heiligen Vater. Sie sollen ihn nicht stören. Sie sollen ihn nicht ansprechen. Und, am wichtigsten, Sie sollen keiner Menschenseele sagen, dass er da ist. Für Sie ist dieser Mann eine Unperson. Er existiert nicht.“ „Und wo soll ich diese Unperson unterbringen?“, fragte Margherita. „In der Herrensuite, mit Blick auf den Swimmingpool. Und entfernen Sie alles aus dem Salon, einschließlich Gemälde undWandteppiche. Er möchte ihn zum Arbeiten benutzen.“ „Alles?“ „Alles.“ „Wird Anna für ihn kochen?“ „Ich habe ihm ihre Dienste angeboten, aber bis jetzt noch keine Antwort erhalten.“ „Wird er Gäste empfangen?“ „Das ist nicht auszuschließen.“ „Wann dürfen wir mit ihm rechnen?“ „Das will er nicht sagen. Er hält sich recht bedeckt, unser Signor Vianelli.“ Wie sich herausstellte, traf er mitten in der Nacht ein – irgendwann nach drei, laut Margherita, die zu der Zeit in ihrem Zimmer über der Kapelle schlief und vom Lärm seines Autos geweckt wurde. Sie erhaschte einen flüchtigen Blick von ihm, als er im Mondlicht über den Hof huschte, ein dunkelhaariger Mann, dünn wie ein Stecken, in der einen Hand einen Seesack und in der anderen eine Maglite. Im Schein der Taschenlampe las er den Zettel, den sie am Eingang der Villa angebracht hatte, dann schlüpfte er hinein wie ein Dieb, der in sein eigenes Haus schleicht. Augenblicke später ging im Schlafzimmer der Herrensuite Licht an, und sie konnte sehen, wie er ruhelos umherstreifte, als suche er einen verlorenen Gegenstand. Kurz tauchte er am Fenster auf, und mehrere Sekunden lang starrten sie einander über den Hof hinweg an. Dann bedachte er sie mit einem kurzen soldatischen Nicken und schloss mit einem energischen Knall die Fensterläden. Richtig begrüßten sie einander am nächsten Morgen beim Frühstück. Nach einem höflichen, aber kühlen Austausch von Nettigkeiten eröffnete er ihr, dass er in die Villa dei Fiori gekommen sei, um zu arbeiten. Sobald er mit dieser Arbeit beginne, so erklärte er, seien Lärmund Störungen auf ein Mindestmaß zu beschränken, ohne allerdings näher darauf einzugehen, worin diese Arbeit bestehe und wie man wissen solle, wann er damit begonnen habe. Des Weiteren verbot er Margherita strikt, seine Räumlichkeiten zu betreten, und teilte einer am Boden zerstörten Anna mit, dass er sich seine Mahlzeiten selbst bereiten werde. Als Margherita den übrigen Bediensteten ausführlich von dem Gespräch berichtete, beschrieb sie sein Benehmen als „reserviert“. Anna, die sofort eine tiefe Abneigung gegen ihn ge- fasst hatte, war in ihrem Urteil weit weniger nachsichtig: „Grässlich ungehobelt“, befand sie. „Je schneller er wieder verschwindet, desto besser.“ Sein Leben folgte bald einer strengen Routine. Nach einem spartanischen Frühstück, bestehend aus Espresso und trockenem Toast, brach er zu einem langen Gewaltmarsch über das Landgut auf. Anfangs schrie er die Hunde an, wenn sie ihm nachliefen, doch nach einiger Zeit fand er sich mit ihrer Gesellschaft ab. Er spazierte durch die Olivenhaine und Sonnenblumenfelder und wagte sich sogar in denWald. Als Carlos ihn beschwor, wegen der Wildschweine doch eine Schrotflinte mitzunehmen, versicherte er ihm gelassen, er könne schon auf sich aufpassen. Nach dem Fußmarsch brachte er eine Weile damit zu, seine Unterkunft zu reinigen und Wäsche zu waschen, dann bereitete er sich ein leichtes Mittagsmahl – gewöhnlich ein Stück Brot mit hiesigem Käse oder,wenn er besonders abenteuerlustig gestimmt war, Pasta mit Tomatensoße aus der Dose. Anschließend ließ er sich, nachdem er im Pool einige stramme Bahnen geschwommen war, mit einer Flasche Orvieto und einem Stapel Bücher über italienische Maler im Garten nieder. Sein Auto, ein verbeulter VWPassat, setzte eine dicke Staubschicht an, denn er verließ das Anwesen kein einziges Mal. Anna ging grollend für ihn auf den Markt und füllte ihren Korb mit der Miene einer Virtuosin, die gezwungen ist, eine einfache Kindermelodie zu spielen. Einmal versuchte sie, ein paar lokale Gaumenfreuden durch seine Verteidigungslinie zu schmuggeln, doch als sie am nächsten Morgen zur Arbeit erschien, lag die Schmuggelware auf der Küchentheke, zusammen mit einem Zettel, auf dem stand, sie habe die Sachen versehentlich in seinem Kühlschrank vergessen. Seine Handschrift war exquisit. Während die Tage in ruhiger Gleichförmigkeit verstrichen, wurden die Unperson namens Alessio Vianelli und die Natur seiner geheimnisvollen Arbeit im Auftrag des Heiligen Vaters für das Personal der Villa dei Fiori zum Gegenstand heftiger Spekulationen. Margherita, selbst eine launische Natur, hielt ihn für einen Missionar, der unlängst aus irgendeiner unwirtlichen Weltgegend zurückgekehrt war. Anna vermutete in ihm einen gefallenen Priester, der ins umbrische Exil verbannt worden war, doch andererseits neigte Anna dazu, stets das Schlimmste in ihm zu sehen. Isabella, die empfindsame Halbschwedin, die das Gestüt leitete, glaubte, er sei ein einsiedlerischer Theologe, der an einem wichtigen Kirchenpapier arbeite. Carlos, der argentinische Gaucho, der das Vieh hütete, hielt ihn für einen Agenten des Vatikan-Geheimdienstes. Zur Stützung dieser Theorie verwies er auf Signor Vianellis Italienisch, das, obschon flüssig, von einem schwachen Akzent gefärbt sei, der langjährige Aufenthalte im Ausland vermuten lasse. Und dann seien da noch diese Augen mit ihrem verstörenden smaragdgrünen Ton. „Seht in diese Augen, wenn ihr euch traut“, sagte Carlos. „Er hat die Augen eines Mannes, der den Tod kennt.“ Die zweite Woche brachte eine Reihe von Ereignissen, die das Rätsel nur noch vergrößerten. Das erste war die Ankunft einer groß gewachsenen jungen Frau mit widerspenstigen kastanienbraunen Haaren und karamellfarbenen Augen. Sie hieß Francesca, sprach Italienisch mit ausgeprägt venezianischem Akzent und entpuppte sich als der frische Wind, der dringend benötigt wurde. Sie unternahm Ausritte – „Sie reitet nicht übel“, wie Isabella die anderen informierte – und organisierte komplizierte Spiele mit den Ziegen und Hunden. Heimlich gestattete sie Margherita, in Signore Vianellis Räumen zu putzen, und ermunterte Anna sogar zum Kochen. Ob sie Mann und Frau waren, blieb unklar. Aber zwei Dinge wusste Margherita mit Bestimmtheit: Signor Vianelli und Francesca teilten sich ein Bett, und seine Laune hatte sich seit ihrer Ankunft deutlich gebessert. Und dann waren da die Lieferwagen. Der erste brachte einen jener weißen Tische, wie man sie in professionellen Labors findet, der zweite ein großes Mikroskop mit flexiblem Stativarm. Dann kamen zwei Lampen, die, wenn man sie anmachte, die ganze Villa in einem intensiven weißen Licht erstrahlen ließen, und eine Kiste mit Chemikalien, von deren Gestank Margherita beim Öffnen fast die Sinne schwanden. In rascher Folge trafen weitere Sendungen ein: zwei große Staffeleien aus lackierter Eiche, eine merkwürdig aussehende Lupenbrille, Wattebündel, Holzbearbeitungswerkzeuge, Dübel, Pinsel, hochwertige Bindemittel und mehrere Dutzend Gefäße mit Pigmenten. Drei Wochen nach Signor Vianellis Ankunft kroch schließlich ein dunkelgrüner Lieferwagen die von Bäumen gesäumte Zufahrt herauf, gefolgt von einer offiziell aussehenden Lancia-Limousine. Beide Fahrzeuge hatten keinerlei Abzeichen, aber die Buchstabenfolge SCV auf ihrem Nummernschild verriet ihre Verbindung zum Heiligen Stuhl. Aus dem Laderaum des Lieferwagens kam ein großes, scheußliches Gemälde zum Vorschein, auf dem zu sehen war, wie ein Mann ausgeweidet wurde. Es wurde unverzüglich in Graf Gasparris Salon getragen und auf die beiden großen Staffeleien gestellt. Isabella, die Kunstgeschichte studiert hatte, ehe sie ihr Leben den Pferden widmete, erkannte in dem Kunstwerk sofort das Martyrium des heiligen Erasmus, gemalt vom französischen Maler Nicolas Poussin. Im Jahr 1628 vom Vatikan in Auftrag gegeben und im Stil Caravaggios ausgeführt, wurde es heute in der Pinakothek der Vatikanischen Museen aufbewahrt. Noch am selben Abend verkündete sie am Esstisch des Personals, dass das Rätsel gelüftet sei. Signor Alessio Vianelli sei ein berühmter Kunstrestaurator. Und er sei vom Vatikan damit betraut worden, ein Gemälde zu retten. Seine Tage nahmen einen ausgesprochen klösterlichen Rhythmus an. Er arbeitete vom Morgengrauen bis zum Mittag durch, verschlief die heißen Nachmittagsstunden und arbeitete dann wieder von der Abenddämmerung bis zum Essen. In der ersten Woche blieb das Gemälde auf dem Arbeitstisch, wo er mit dem Mikroskop die Oberfläche untersuchte, eine Reihe von Detailfotos machte und Schäden an Leinwand und Rahmen reparierte. Dann stellte er das Gemälde auf die Staffeleien und begann, den Oberflächenschmutz und den vergilbten Firnis zu entfernen. Dies war ein äußerst mühsames Unterfangen. Zunächst fertigte er unter Verwendung eines Wattebausches und eines Holzdübels einen Tupfer an. Dann tauchte er den Tupfer in Lösungsmittel und säuberte die Oberfläche des Bildes mit kreisförmigen Bewegungen – behutsam, wie Isabella den anderen erklärte, damit die Farbe nicht verwischt wurde. Mit einem Tupfer ließen sich ungefähr sechs Quadratzentimeter des Gemäldes reinigen. Wurde er zu schmutzig, ließ er ihn einfach zu Boden fallen und machte sich einen neuen. Laut Margherita war das so, als ob man die gesamte Villa mit einer Zahnbürste putze. „Kein Wunder, dass er ein komischer Kauz ist“, sagte sie. „Seine Arbeit treibt ihn zumWahnsinn.“ Als der alte Firnis entfernt war, trug er einen schützenden Zwischenfirnis auf die Leinwand auf und nahm die letzte Phase der Restaurierung in Angriff, die Retuschierung jener Teile des Gemäldes, an denen der Zahn der Zeit genagt hatte. Dabei kopierte er Poussin so perfekt, dass unmöglich zu sagen war, wo der Strich des alten Meisters endete und seiner anfing. Er fügte sogar eine künstliche Craquelure, wie das spinnwebartige Netz feiner Oberflächenrisse genannt wurde, hinzu, sodass sich die neue übergangslos an die alte fügte. Isabella kannte die italienischen Kunstkreise gut genug, um zu begreifen, dass Signor Vianelli kein ge- wöhnlicher Restaurator war. Er musste etwas Besonderes sein. Die Männer im Vatikan hatten ihm ihr Meisterwerk nicht ohne Grund anvertraut. Aber warum arbeitete er hier, auf einem abgelegenen Gut in den umbrischen Hügeln, und nicht in den hochmodernen Konservierungslabors des Vatikans? Sie sann an einem strahlenden Nachmittag Anfang Juni über diese Frage nach, als sie den Wagen des Restaurators die Zufahrt hinunterrasen sah. Er winkte ihr soldatisch knapp zu, als er an den Stallungen vorbeibrauste, und war im nächsten Moment hinter einer hellgrauen Staubwolke verschwunden. Den restlichen Nachmittag brütete Isabella über einer anderen Frage. Warum fuhr er, nachdem er fünf Wochen lang wie ein Gefangener in der Villa gelebt hatte, plötzlich zum ersten Mal fort? Sie sollte es nie erfahren, denn den Restaurator hatte der Ruf anderer Auftraggeber ereilt. Was den Poussin anging, so sollte er ihn nie wieder anrühren.
3
Assisi, Italien
Wenige italienische Städte bewältigen den Ansturm der Touristen im Sommer eleganter als Assisi. Die Pauschalpilger kommen am Vormittag und trippeln bis zum Dunkelwerden gesittet durch die heiligen Gassen, dann werden sie wieder in die klimatisierten Reisebusse gepfercht und nach Rom in ihre preiswerten Hotels zurückgekarrt. An die westliche Stadtmauer gelehnt, beobachtete der Restaurator, wie sich eine Gruppe übergewichtiger deutscher Nachzügler mit schweren Schritten durch den Steinbogen der Porta Nuova schleppte. Dann ging er hinüber zu einem Zeitungskiosk und kaufte sich die gestrige Ausgabe der International Herald Tribune. Der Kauf hatte, wie sein Besuch in Assisi, berufliche Gründe. Die Herald Tribune signalisierte, dass er nicht beschattet wurde. Hätte er die Repubblica oder irgendeine andere italienischsprachige Zeitung gekauft, hätte dies bedeutet, dass er von Agenten des italienischen Sicherheitsdienstes verfolgt wurde, und das Treffen wäre abgesagt worden. Er klemmte sich die Zeitung so unter den Arm, dass der Titelkopf nach außen schaute, und ging durch den Corso Mazzini zur Piazza del Comune. Auf dem Rand eines Brunnens saß ein Mädchen in ausgewaschenen Jeans und einem hauchdünnen Baumwolltop. Sie schob ihre Sonnenbrille in die Stirn und spähte über den Platz zur Einmündung in die Via Portica. Der Restaurator warf die Zeitung in einen Abfalleimer und lenkte seine Schritte in die schmale Gasse.
Das Restaurant, das er laut Anweisung aufsuchen sollte, lag ungefähr hundert Meter von der Basilika San Francesco entfernt. Er sagte der Wirtin, dass er mit einem Monsieur Laffont verabredet sei, und wurde sogleich auf eine schmale Terrasse mit weitem Ausblick über das Tibertal geführt. Der hintere Teil der Terrasse, zu dem eine enge Steintreppe hinaufführte, bestand aus einer kleinen Veranda mit lediglich einem Tisch. Topfgeranien säumten die Balustrade, und darüber spannte sich ein Dach aus blühendem Wein. Vor einer entkorkten Flasche Weißwein saß ein Mann mit kurz geschnittenem, rotblondem Haar und den kräftigen Schultern eines Ringers. Den Namen Laffont trug er nur während der Arbeit. In Wirklichkeit hieß er Uzi Navot und gehörte den obersten Rängen des israelischen Nachrichtendienstes an. Er war einer der wenigen Menschen auf der Welt, die wussten, dass der italienische Kunstrestaurator Alessio Vianelli in Wirklichkeit ein Israeli aus dem Jesreel-Tal namens Gabriel Allon war. „Schöner Tisch“, sagte Gabriel, als er Platz nahm. „Das ist eine der positiven Begleiterscheinungen dieses Lebens. Wir kennen die besten Tische in den besten Restaurants Europas.“ Gabriel goss sich selbst ein Glas Wein ein und nickte bedächtig. Ja, sie kannten alle besten Restaurants, aber sie kannten auch alle tristen Flughafenlounges, alle stinkenden Bahnsteige und alle schäbigen Transit-Hotels. Das vermeintlich glamouröse Leben eines israelischen Geheimagenten bestand in Wahrheit aus nahezu rastlosem Reisen und stumpfsinniger Langeweile, nur gelegentlich unterbrochen von kurzen Phasen blanken Entsetzens. Gabriel Allon hatte mehr solche Phasen erlebt als die meisten Agenten. Dies galt im Übrigen auch für Uzi Navot. „Früher bin ich mit einem Informanten hierhergekommen “, sagte Navot. „Einem Syrer, der bei einem staatlichen Pharmaunternehmen gearbeitet hat. Seine Aufgabe war die Beschaffung von Chemikalien und Geräten europäischer Hersteller. Aber das war natürlich nur Tarnung. InWahrheit arbeitete er am syrischen Chemie- und Biowaffenprogramm mit. Wir haben uns zweimal hier getroffen. Ich habe ihm einen Koffer gegeben, voll mit Geld und drei Flaschen von diesem herrlichen umbrischen Sauvignon Blanc, und er hat mir die dunkelsten Geheimnisse des Regimes erzählt. Die Zentrale beklagte sich immer bitter über die Höhe der Rechnung.“ Navot schmunzelte und schüttelte langsam den Kopf. „Diese Idioten in der Buchhaltung haben mir anstandslos einen Koffer mit hunderttausend Dollar drin gegeben, aber wenn ich mein Spesenkonto nur um einen Schekel überzogen habe, gab es ein Donnerwetter. So ist wohl das Leben eines Buchhalters am King Saul Boulevard.“ Der King Saul Boulevard war seit vielen Jahren die Adresse des israelischen Auslandsgeheimdienstes. Der Dienst hatte einen langen Namen, der nur sehr wenig über seinen wirklichen Auftrag aussagte. Für Männer wie Gabriel und Uzi Navot war er einfach nur „der Dienst“, sonst nichts. „Steht er noch auf der Gehaltsliste?“ „Der Syrer?“ Die Rolle Monsieur Laffonts spielend, verzog Navot die Lippen zu einem Pariser Flunsch. „Bedauerlicherweise ist ihm vor einigen Jahren ein Malheur unterlaufen.“ „Inwiefern?“, fragte Gabriel vorsichtig. Er wusste, dass es meistens tödlich endete, wenn einer Person, die mit dem Dienst in Verbindung stand, ein Malheur unterlief. „Agenten der syrischen Spionageabwehr haben ihn beim Betreten einer Bank in Genf fotografiert. Tags darauf wurde er auf dem Flughafen in Damaskus verhaftet und in die Palästinensische Abteilung‹ gebracht.“ „Palästinensische Abteilung “ war der Name des wichtigsten syrischen Verhörzentrums. „Sie haben ihn einen Monat lang gefoltert. Als sie alles aus ihm herausgequetscht hatten, was es herauszuquetschen gab, haben sie ihm eine Kugel in den Kopf gejagt und seine Leiche in ein anonymes Grab geworfen.“ Gabriel blickte zu den anderen Tischen hinunter. Das Mädchen von der Piazza saß nun allein in der Nähe des Eingangs. Die Speisekarte lag aufgeschlagen vor ihr, aber ihre Augen wanderten langsam über die anderen Gäste. Zu ihren Füßen stand eine übergroße Handtasche mit geöffnetem Reißverschluss. Gabriel wusste, dass in der Tasche eine geladene Schusswaffe steckte. „Wer ist die bat leveja?“ „Tamara“, antwortete Navot. „Sie ist neu.“ „Und auch sehr hübsch.“ „Ja“, sagte Navot, als wäre ihm das noch gar nicht aufgefallen. „Ihr hättet eine nehmen können, die über dreißig ist.“ „So kurzfristig war keine andere zu bekommen.“ „Dass Sie mir sauber bleiben, Monsieur Laffont.“ „Die Tage heißer Affären mit weiblichen Begleitoffizieren sind offiziell vorüber.“ Navot nahm die Brille ab und legte sie vor sich auf den Tisch. Sie war hochmodisch und viel zu klein für sein breites Gesicht. „Bella findet, dass wir endlich heiraten sollten.“ „Daher die neue Brille. Du bist jetzt Leiter der Operationsabteilung, Uzi. Du solltest eigentlich in der Lage sein, dir selbst eine Brille auszusuchen.“ Die Operationsabteilung war, um mit dem berühmten israelischen Meisterspion Ari Schamron zu sprechen, „die dunkle Seite eines dunklen Dienstes“. Ihre Leute übernahmen die Aufträge, zu denen sonst niemand Lust oder Mut hatte. Sie waren Scharfrichter und Kidnapper, Abhörspezialisten und Erpresser, intelligente und einfallsreiche Männer, die eine größere kriminelle Energie hatten als die Kriminellen selbst, mehrsprachige Chamäleons, die in den besten europäischen Hotels und Salons ebenso zu Hause waren wie in den finstersten Gassen Beiruts oder Bagdads. „Ich dachte, Bella hätte genug von dir“, sagte Gabriel. „Ich dachte, eure Beziehung liegt in den letzten Zügen.“ „Deine Hochzeit mit Chiara hat ihr den Glauben an die Liebe zurückgegeben. Im Moment stehen wir in zermürbenden Verhandlungen über Zeit und Ort.“ Navot runzelte die Stirn. „Mit den Palästinensern den Status Jerusalems auszuhandeln dürfte, glaube ich, leichter werden, als sich mit Bella über die Hochzeitspläne zu einigen.“ Gabriel hob seinWeinglas ein paar Zentimeter vom weißen Tischtuch und murmelte: „Masl-tow, Uzi.“ „Du hast leicht reden, Gabriel“, erwiderte Navot finster. „Du hast die Latte für unsereins ziemlich hoch gehängt. Man muss sich das mal vorstellen, eine Überraschungshochzeit, perfekt geplant und durchgeführt – das Kleid, das Essen, sogar die Gedecke, genau wie es Chiara wollte. Und jetzt verbringst du deine Flitterwochen in einer abgelegenen Villa in Umbrien und restaurierst für den Papst ein Gemälde. Wie soll ein gewöhnlicher Sterblicher wie ich da mithalten?“ „Ich hatte Hilfe“, grinste Gabriel. „Die Operationsabteilung hat bei den Vorbereitungen doch exzellente Arbeit geleistet, findest du nicht?“ „Wenn unsere Feinde spitzkriegen, dass die Operationsabteilung eine Hochzeit ausgerichtet hat, ist unser Ruf ruiniert.“ Ein Kellner kam die Treppe herauf und steuerte auf den Tisch zu. Navot gebot ihm mit einem kurzen Handzeichen Einhalt und schenkte GabrielWein nach. „Der Alte lässt dich herzlich grüßen.“ „Das habe ich mir schon gedacht“, sagte Gabriel geistesabwesend. „Wie geht es ihm?“ „Er beginnt zu murren.“ „Was stört ihn denn jetzt wieder?“ „Deine Sicherheitsvorkehrungen in der Villa. Er findet sie alles andere als zufriedenstellend.“ „Genau fünf Leute wissen, dass ich im Land bin: der italienische Ministerpräsident, die Chefs seiner Nachrichtenund Sicherheitsdienste, der Papst und der Privatsekretär des Papstes.“ „Er hält die Sicherheitsvorkehrungen trotzdem für unzureichend. “ Navot zögerte. „Und in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen muss ich ihm leider recht geben.“ „Welcher jüngsten Entwicklungen?“ Navot legte seine großen Arme auf den Tisch und lehnte sich ein paar Zentimeter vor. „Aus unseren Quellen in Ägypten haben wir gehört, dass Scheich Tayyib anscheinend ziemlich aufgebracht ist, weil du seinen ausgeklügelten Plan zum Sturz der Regierung Mubarak durchkreuzt hast. Er hat alle Mitglieder vom Schwert Allahs in Europa und Nahost instruiert, sofort nach dir zu fahnden. Letzte Woche ist ein Agent des Schwerts rüber nach Gaza und hat die Hamas gebeten, sich an der Suche zu beteiligen.“ „Ich nehme an, unsere Freunde von der Hamas haben ihre Hilfe zugesagt.“ „Ohne zu zögern.“ Navots folgendeWorte wurden nicht auf Französisch gesprochen, sondern leise auf Hebräisch. „Wie du dir denken kannst, kennt der Alte die Berichte über die sich häufenden Todesdrohungen gegen dich, und er hat nur den einen Gedanken:Warum sitzt Gabriel Allon, Israels Racheengel und fähigster Geheimagent, auf einem Rinderhof in den umbrischen Hügeln und restauriert für Seine Heiligkeit Papst Paul VII. ein Gemälde?“ Gabriel betrachtete die Aussicht. Die Sonne senkte sich auf die fernen Hügel im Westen, und im Talgrund gingen die ersten Lichter an. Ein Bild blitzte in seiner Erinnerung auf: Ein Mann mit einer Pistole in der ausgestreckten Hand feuert am Fuß des Nordturms vonWestminster Abbey in das Gesicht eines gefallenen Terroristen. Es erschien ihm in Öl auf Leinwand, wie von Caravaggio gemalt. „Der Engel ist in den Flitterwochen“, sagte er, den Blick noch ins Tal gerichtet. „Und der Engel ist nicht in der Verfassung, wieder zu arbeiten.“ „Wir bekommen keine Flitterwochen, Gabriel – jedenfalls keine richtigen.Was deinen Gesundheitszustand angeht, bist du in der Gewalt der Terroristen vom Schwert Allahs weiß Gott durch die Hölle gegangen. Niemand würde es dir verübeln, wenn du dem Dienst diesmal endgültig den Rücken kehrst.“ „Niemand außer Schamron, versteht sich.“ Navot zupfte am Tischtuch, gab aber keine Antwort. Es war nunmehr fast zehn Jahre her, dass Ari Schamron den Chefsessel geräumt hatte, doch noch immer mischte er in den Angelegenheiten des Dienstes mit, als sei er sein Privatreich. Jahrelang hatte er dies von der Kaplanstraße in Jerusalem aus getan, wo er den Ministerpräsidenten in Sicherheits- und Anti-Terror-Fragen beraten hatte. Nun, gealtert und noch von den Folgen eines Terroranschlags auf seinen Dienstwagen geschwächt, drehte er von seiner festungsähnlichen Villa am See Genezareth aus an den Hebeln der Macht. „Schamron will mich in Jerusalem in einen Käfig sperren “, sagte Gabriel. „Er glaubt, dass mir gar nichts anderes übrig bleibt, als die Leitung des Dienstes zu übernehmen, wenn er mir das Leben nur sauer genug macht.“ „Es gibt Schlimmeres im Leben, Gabriel. Unzählige Männer würden ihren rechten Arm opfern, nur um mit dir tauschen zu können.“ Navot verfiel in Schweigen, dann setzte er hinzu: „Mich eingeschlossen.“ „Du musst deine Chance nur richtig nutzen, Uzi, dann gehört der Job eines Tages dir.“ „So habe ich den Posten als Leiter der Operationsabteilung bekommen – weil du ihn nicht wolltest. Ich habe mein ganzes Berufsleben über in deinem Schatten gestanden, Gabriel. Das ist nicht leicht. Ich komme mir vor wie ein Trostpreis.“ „Da gibt es keine Trostpreise, Uzi. Wenn sie nicht der Meinung wären, dass du der Richtige für den Job bist, hätten sie dich in Europa gelassen und sich jemand anders gesucht.“ Navot wollte offenbar das Thema wechseln. „Lass uns etwas essen“, schlug er vor. „Sonst kommt der Kellner noch auf die Idee, dass wir zwei Spione sind, die etwasWichtiges zu besprechen haben.“ „Bist du deswegen hier, Uzi? Du bist doch sicher nicht den weitenWeg nach Umbrien gekommen, nur um mir zu sagen, dass es Leute gibt, die mich gern tot sehen würden.“ „Nun ja, wir fragen uns, ob du eventuell bereit wärst, uns einen Gefallen zu tun.“ „Was für eine Art von Gefallen?“ Navot schlug die Speisekarte auf und runzelte die Stirn. „Mein Gott, sieh dir all die Pasta an.“ „Magst du denn keine Pasta, Uzi?“ „Ich liebe Pasta, aber Bella sagt, dass ich fett davon werde.“ Er rieb sich den Nasenrücken und setzte die neue Brille wieder auf. „Wie viel musst du vor der Hochzeit abspecken, Uzi?“ „Dreißig Pfund“, knurrte Navot. „Dreißig Pfund!“
„Perfekte Unterhaltungsliteratur zum In-einem-Rutsch-Lesen.“
„›Das Moskau-Komplott‹ ist ein intelligenter, komplexer, aber keineswegs komplizierter Thriller, bei dem man den Faden verlieren könnte. Die Geschichte kommt frisch daher, ist flüssig geschrieben und reißt einen mit, als treibe man in einem rauschenden Storm. Nirgends macht Spionage mehr Spaß als in den Büchern von Daniel Silva.“


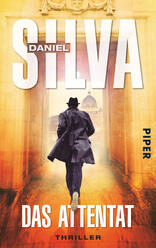

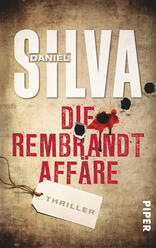














DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.