

Das Leben und Sterben der Flugzeuge
Roman
„Lohnt sich!“ - Dresdner Morgenpost
Das Leben und Sterben der Flugzeuge — Inhalt
Kann man ein gewöhnlicher Pariser Bahnhofsspatz sein und gleichzeitig ein deutscher Kommissar namens Blind? Kann es in Belfast ein Hochhaus mit einer geheimen Etage geben, das für Spatz und Kommissar lebenswichtig ist, obwohl dieser Wolkenkratzer nie gebaut wurde? Und vor allem: Kann an einem verborgenen Ort das Wrack eines Flugzeugs der Malaysia Airlines liegen, das doch erst Monate später spurlos verschwinden wird? Steinfests Gratwanderung zwischen Phantastischem und Realität gerät zu einem literarischen Drahtseilakt, der die Lektüre dieses Romans zu einem atemberaubenden Vergnügen macht.
Leseprobe zu „Das Leben und Sterben der Flugzeuge“
Abschlag
„Du stehst falsch, Schatz.“
Ich dachte mir: „Na, das kommt drauf an.“ Und genauer: „Das kommt drauf an, was man vorhat.“
Ich spürte, wie die Frau, die mich „Schatz“ nannte, von hinten meine beiden Schultern berührte und mit leichtem Druck versuchte, meinen Körper in eine Position zu dirigieren, die geeignet war, den Golfball hinunter auf den Fairway zu spielen. Statt hinein in die Bäume, wie zu befürchten war, sollte ich so stehenbleiben, wie ich stand.
Über den Sinn des Golfspiels kann man streiten. Erst recht, wenn der Spieler blind ist. Richtig [...]
Abschlag
„Du stehst falsch, Schatz.“
Ich dachte mir: „Na, das kommt drauf an.“ Und genauer: „Das kommt drauf an, was man vorhat.“
Ich spürte, wie die Frau, die mich „Schatz“ nannte, von hinten meine beiden Schultern berührte und mit leichtem Druck versuchte, meinen Körper in eine Position zu dirigieren, die geeignet war, den Golfball hinunter auf den Fairway zu spielen. Statt hinein in die Bäume, wie zu befürchten war, sollte ich so stehenbleiben, wie ich stand.
Über den Sinn des Golfspiels kann man streiten. Erst recht, wenn der Spieler blind ist. Richtig blind. Mein Augenlicht ist vor Jahren verloschen. Vieles kenne ich von früher, als ich noch sehen konnte. Etwa auch diesen Golfplatz, der sich glücklicherweise kaum verändert hat.
Im Wissen um das eigene langsame Erblinden schaut man sich die Welt sehr viel genauer an, als wenn man sich ihres Anblicks sicher zu glauben meint. Welcher Sehende könnte aus dem Gedächtnis schon sagen, wo denn alle Dinge stehen und wie ihre äußere Form beschaffen ist? Wobei ich nicht sagen will, die visuelle Welt auswendig gelernt zu haben sei ein guter Ersatz für die Schlampigkeit derer, die sehen. Natürlich wäre ich lieber geblieben, was ich war: ein nachlässig Sehender statt ein genauer Blinder. Doch das ging eben nicht. Die Blindheit zwang mich zur Präzision.
Freilich stolpern auch Blinde. Und auch blinde Golfspieler stehen mitunter falsch zum Ball, falsch zum Platz und zielen in die falsche Richtung.
Die Frau hinter mir – eine gute Freundin, die sich die spezielle Anrede erlauben durfte – meinte also, mich ein wenig umlenken zu müssen, damit ich meinen Ball nicht ins sogenannte Rauhe schlug, einen Bereich unberührter oder wenigstens fast unberührter Natur. Wobei das Rauhe an dieser Stelle gar nichts Rauhes hatte, eher lieblich zu nennen war: ein Wäldchen aus hohen Bäumen und Hecken, so gut wie undurchdringlich, an dessen Rand ich Jahre zuvor einmal einen Parasol gefunden hatte, also einen Gemeinen Riesenschirmling, einen herrlichen Speisepilz. – Klar, das Pilzesammeln hatte ich aufgegeben, das wäre dann doch zu weit gegangen; als Pilze sammelnder Blinder wäre ich mir wie ein Clown vorgekommen.
Ach ja?! Und kleine Bälle blindlings in ebenfalls nicht sehr große Löcher zu schlagen, war das keine Clownerie? – Nun, es war nicht so, daß ich einbeinig oder einarmig auf Berge stieg und dabei die Luft anhielt oder auf einem Rollstuhl einen ganzen Marathon auszusitzen versuchte, sondern ich schlug meinen Ball in der gewohnten Weise über den mir vertrauten Platz. Wobei ich diesen Ball sogar besser wahrnahm als früher. In der Dunkelheit, in der ich nun lebte – mehr ein Blau als ein Schwarz, aber das satteste Blau, das sich denken läßt –, erschien mir der Ball als ein großer, fetter Leuchtkäfer. Gut, das war natürlich ein eingebildeter Ball, doch er befand sich stets exakt an der Stelle, wo ich auch den tatsächlichen Ball plaziert hatte. Während wiederum die Landschaft vor meinem geistigen Auge etwas von einer Skizze besaß: zarte Linien, umrißartig, aber perfekt gestrichelt. Ein Golfplatz, gezeichnet wie von Gustav Klimt – eine nackte liegende Dame als domestizierte Natur. (Ich bin mit Klimt aufgewachsen, meine Mutter liebte ihn. Und überall sehe ich seine Frauen eingebunden, erst recht, seitdem ich blind bin.)
Ich stand also ein wenig falsch und bemerkte die leichte Irritation meiner Golffreunde, die so etwas nicht gewohnt waren. Noch nie war ich falsch gestanden, schon gar nicht beim Abschlag.
Ich aber beharrte: „Ich bin schon richtig, danke.“
Die Hände der guten Freundin glitten von meinen Schultern, als hätte mir jemand zwei kleine Singvögel heruntergeschossen.
Worauf ich erklärte: „Heute versuche ich mal einen Double Albatross.“
Nun, das war absurd, weil man einen Double Albatross nicht versuchte. Man kündigte ihn nicht an, sondern er geschah wie ein Wunder. Und zwar ein seltenes, was zu einem Wunder wiederum bestens paßt.
Double Albatross bedeutete, daß man auf einer Bahn, für die ein Topspieler durchschnittlich fünf Schläge benötigte, mit einem einzigen Schlag einlochte, einem Hole-in-one. Etwas, was den normalen Bedingungen und Möglichkeiten einer Anlage widersprach, die ja ganz darauf ausgerichtet war, es einem schwer und nicht leicht zu machen. Einen solchen Schlag gab es derart selten, daß man nicht einmal darauf wetten konnte (und heutzutage auf etwas nicht wetten zu können war an sich schon ein Wunder. Das ganze Leben kann einem als eine Wette erscheinen und darin die Wirtschaft als die Wette schlechthin – aber das galt offensichtlich nicht dafür, auf einen doppelten Seevogel zu setzen).
Realistisch wurde ein solcher Schlag nur, wenn die Architektur des Platzes sowie die Architektur des soeben blasenden Windes dies zuließen und somit ein perfektes, wenngleich verrücktes „Haus“ entstand. Und natürlich der Spieler selbst verrückt genug war, das Wesen dieses Hauses zu erkennen und nutzen zu wollen.
Ich war verrückt genug. Und blind. Sehend hätte ich es gar nicht erst versucht.
Die Spielbahn, an dessen Abschlagbereich wir standen, hatte in etwa die Form eines Bumerangs, auf dessen längerem rechten Flügel wir uns aufhielten, während das weit entfernte Loch am Ende des etwas kürzeren linken Flügels lag. In der Tat wurde dieser Fairway intern der „Australian Way“ genannt. In der gewaltigen Achselhöhle, die zwischen den beiden Flügeln und der verbindenden Biegung lag, befand sich jenes Rauhe in Gestalt einer dichten und üppigen und windbewegten Waldlandschaft, in der auch schon mal Pilze wuchsen und eine kleine Tierwelt versammelt war. Um auf dieser Spielbahn einen Double Albatross zu spielen, ihn zu wagen, war es also nötig, daß man die beträchtliche Strecke von 450 Metern mit all ihren schmucken Hindernissen umging und stattdessen den Ball in direkter Linie über das Waldstück schlug. Auf daß der Ball auf der anderen Seite landen und den steil abfallenden Hang hinunter zum sogenannten Grün rollen konnte, also zu jenem besonders kurz geschorenen Bereich, der im Vergleich zu den anderen Rasenflächen eines Golfplatzes gar nicht so grün wirkt, eher blaß: ein krankes Grün, ein Grün mit Migräne. Darin das zielgebende Loch.
Keine Frage, die Wahrscheinlichkeit, daß der Ball in den Wald flog und dort einen Hasen oder ein Reh traf, war um einiges größer (dafür hätte sich vielleicht sogar ein Wettbüro gefunden), als ihn über die Wipfel oder durch die Lücken im Geäst zu schlagen und ungebremst auf die andere Seite zu befördern, hinein in das migränoide Grün und von diesem ins Loch.
Aber genau das war es, was ich vorhatte. Nicht zuletzt, weil ich den günstigen Wind bemerkte und mir die feine Landschaftsskizze in meinem Kopf – die auf ihre linke Seite gebettete dösende Klimt-Frau – eine vorzügliche Flugbahn suggerierte, wie in einem Video, wenn die eingeblendete Flugkurve dem Zuseher die ideale Zukunft eines Schlags vorgaukelt. Die beste aller möglichen Welten dank des besten aller möglichen Winde.
Ich erklärte also meinen Freunden, ich würde schon richtig stehen, faßte den Schläger in einer Weise, als würde ich ein Seil halten, an dem drei Kinder – und eins der Kinder mit einem Hund im Arm – über einem Abgrund hängen, holte weit aus und traf den Ball, wie ich ihn noch nie zuvor getroffen hatte.
Ich schwang den Schläger durch, atmete aus und schaute dem Ball hinterher.
Blind, wie ich war, sah ich ihn noch, da war er bereits aus unserem Blickfeld geraten.
*
Ein Buch ist nichts anderes als eine Vorbereitung auf das Sterben – und auf das, was danach kommt, gleich, ob es sich um ein ewiges Gähnen, eine Wiederholung, eine Verwandlung oder um eine Party handelt, eine Party, bei der endlich einmal niemand zu kurz kommt.
I
Quimp
1
Mein Name ist Quimp, und ich bin ein Spatz. Ein richtiggehender, was nicht bedeutet, richtig zu gehen, weil ich ja eher hüpfe und vor allem fliege, aber ich will damit klarstellen, daß ich tatsächlich ein Vogel bin und nicht etwa ein süßer Spatz, wie es von manchen Kindern heißt. Oder wie diese französische Sängerin, die sehr klein und sehr berühmt war und von den Leuten „der Spatz von Paris“ genannt wurde. Das erwähne ich nicht zuletzt darum, weil ich genau dort lebe, in Paris nämlich. Ein Spatz in Paris. Ein junger Spatz, selbständig, frei, flink, ziemlich redegewandt und absolut flugtüchtig, ich bin überlebensfähig.
Denkende und sprechende Tiere, die noch dazu erklären, in welcher Stadt sie leben, werden von den meisten Menschen als etwas Phantastisches und Märchenhaftes abgetan, zumindest von den erwachsenen Menschen. Bei Kindern ist es manchmal anders, aber so was gilt dann weniger als Beweis für ihre Klugheit und Weitsicht, sondern eher für ihre Blödheit. (Auch wenn nicht alle Erwachsenen das so ausdrücken, sondern halt meinen, Kinder würden Dinge sehen und hören, die gar nicht da sind, was sie aber gerne dürfen, solange sie klein sind und dies entwicklungstechnisch zum Kleinsein dazugehört. Später aber nicht mehr. Später ist so was nur mehr erlaubt im Kino und in Büchern und in Träumen, aber nicht im wirklichen Leben. Im wirklichen Leben gilt es sodann als Ausdruck von Verrücktheit.)
Wirkliches Leben der Menschen einerseits und Wahrheit der Natur andererseits ist jedoch zweierlei.
Die Wahrheit ist nämlich, daß Spatzen sehr wohl denken und sehr wohl reden, auch wenn ich nicht behaupten will, es würde immer etwas Intelligentes dabei herauskommen. Keine Frage, es wird auch bei den Spatzen viel Unsinn gesagt. Oft geht es nur um Streit oder Besserwisserei, oder das Gesagte ist einfach dazu da, beim Mundaufmachen Worte herauskommen zu lassen. Lieber etwas zu sagen als nichts. Bei den Spatzen wie bei den Menschen gilt, daß gerade dann, wenn man nichts zu sagen hat, dies besonders vieler Worte bedarf. Würden Spatzen statt Menschen in Talk-shows auftreten, die Talkshows würden darum also nicht unbedingt besser werden.
Natürlich, auch Spatzen werden vom Reden, gleich wie sinnvoll oder sinnlos, selten satt. Die Jagd nach dem Futter bestimmt unser Leben wie bei den Menschen die Jagd nach dem Geld, welches dem Futter vorgeschoben ist. Und damit bin ich schon bei einem Problem, das erst jüngst eines wurde. Vorher habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht.
Die meiste Zeit verbrachte ich im Inneren eines Bahnhofs, des Gare Montparnasse, auch schlief ich dort und trieb mich nur selten in einem der benachbarten Parks herum. Die Parks waren mir fremd, und ich wußte um die Gefahren, die an solchen halbwilden Orten drohen. Im Bahnhof kannte ich mich aus, kannte jede Ritze, jedes Loch, jeden Fluchtweg und durfte mir eines stets gedeckten Tisches sicher sein. Beziehungsweise vieler Tische. All der Tische in den Bistros und Restaurants, die die Hallen und Gänge dieses Bahnhofs füllen und in denen mehr oder weniger gehetzte Menschen sich verköstigen lassen. Und im Zuge dieser Verköstigung kommen auch die Spatzen zu ihrem Futter.
Strenggenommen könnte man sagen, ich und meinesgleichen, wir sind weder Sammler noch Jäger, sondern Diebe. Manchmal Bettler. Manchmal Nervtöter. Wir warten ja nicht einmal mehr, bis die Menschen sich von den Tischen erheben, um den Moment auszunützen, bevor irgendeine Hilfskraft die Überreste abräumt, nein, wir steuern die Plätze an, an denen Erwachsene und Kinder soeben ihre Croissants, ihre Baguettes, ihre Wraps, ihre Muffins und Donuts verzehren, landen an den Kanten der Tischplatten und setzen alle Tricks ein, um an die Mahlzeit zu gelangen. Ich will es ganz deutlich sagen: Wir landen praktisch mitten im Essen von Personen, die uns absolut fremd sind. Von manchen verscheucht, von manchen gefüttert, von manchen nicht einmal bemerkt. Wobei wir im Laufe der Zeit jeglichen Respekt eingebüßt haben, niemanden fürchten. Schon gar nicht jene, die uns wegzujagen versuchen. Solchen Leuten auf den Wecker zu fallen macht besonders viel Freude. Ihre Tische immer wieder anzufliegen und ungeachtet ihrer rudernden Arme ein Stück ihres Essens zu erhaschen, nicht nur das Alte und Stehengelassene, sondern lieber das soeben erst Gekaufte, das noch Ofenfrische. Ofenfrisch ist angeblich ungesund, kann ich aber nicht bestätigen.
All das stellte ich nie in Frage. Warum auch? Niemals litt ich unter Bauchschmerzen oder Übelkeit oder schlechtem Gewissen. Niemals. Ich wuchs auf diesem Bahnhof auf und kannte nichts anderes. Doch dann …
Merkwürdig schon, wie sehr ein bestimmter Moment etwas ändern kann. Ein einziger Blick und eine einzige kritische Bemerkung.
Hier die Geschichte meiner Verwandlung.
Ich saß wie immer in der Dachkonstruktion über meinem Lieblingsbistro und überlegte, welcher Tisch sich am besten eignen würde und ob ich mich eher mit Überresten zufriedengeben oder einen noch besetzten Tisch aufs Korn nehmen sollte. Ich entschied mich für zweiteres. Eine ganze Familie hatte sich soeben niedergelassen, zwei Erwachsene, vier Kinder, und mit ihnen ein Haufen von Speisen. Ich stieß mich ab und stürzte nach unten, bremste kurz davor in der Luft, flog eine Weile im Stand, so in der Kolibriart, und landete schließlich auf der Breitseite des Tisches.
Ich schaute in ihre Gesichter, sie in das meine. Das Übliche: die Eltern skeptisch, weil Eltern nämlich immer die Frage der Hygiene im Kopf haben und sich Tiere, die nicht ihre eigenen sind, vor allem als Krankheitsüberträger denken. Wobei auch solche Eltern oft nicht umhinkommen, einen Vogel wie mich lieb und herzig zu finden. Ihr Gefühl war somit ein gespaltenes. Die Kinder wiederum begeistert ob der Frechheit, mit der ich mich ihnen genähert hatte. Und natürlich begeistert ob meines Aussehens. Es gibt einen Begriff, der das erklärt: Kindchenschema. Was bedeutet, daß mein eigener Kopf eher dem eines kleinen Kindes entspricht. Ich bin wie ein Spiegel, in dem die Kinder sich selbst sehen und die Eltern ihre Kinder, in ein Tier verwandelt.
Aber diesmal … bei einem der Kinder war es anders. Während seine drei Geschwister sofort begannen, Stückchen von ihrem Gebäck abzubrechen und zu mir herüberzuwerfen, so daß ich sogar einen Hüpfer zur Seite machen mußte, um nicht getroffen zu werden, gleich darauf aber einen Krümel geschickt aus seiner Flugbahn pickte, währenddessen also bemerkte ich den Blick des vierten Kindes, eines vielleicht elfjährigen Mädchens, das mich überaus kritisch betrachtete. Kritisch und mit einem deutlichen Widerwillen. Einen Moment dachte ich, sie hätte, als die Älteste der vier, den Hygienewahn der Eltern bereits übernommen und fürchtete darum, ich könnte jetzt gleich mitten auf den Tisch kacken (was ich niemals tue, zumindest nicht absichtlich), aber dann sagte sie etwas, was in eine ganz andere Richtung ging, sie sagte: „Ich glaube nicht, daß dieser Piepmatz es überhaupt noch schaffen würde, sich selbst was zu fangen. Das kriegt der doch gar nicht mehr hin. Schick den in die freie Natur, und er verhungert gleich.“
Sicher, man könnte sagen, dies war die Äußerung eines dieser altklugen Kinder, die ständig ein Haar in der Suppe suchen und natürlich auch finden, aber dennoch, ich merkte, wie ein Gefühl der Scham groß in mir wurde. Ich wäre, wie man so sagt, gerne im Erdboden beziehungsweise in der Tischplatte versunken. Da ich nun aber kein Illusionist bin, stieg ich mit raschem Flügelschlag in die Höhe und flüchtete hinüber zu einer Betonverschalung, aus der ein Stück herausgebrochen ist und sich eine kleine Höhle gebildet hat. Meine Nische. Mein Kabinett. Meine „Ecke“, ein Begriff, den ich vom Boxen kenne. In die eigene Ecke ging man weniger, um seinen Gegner nicht mehr zu schlagen, als um selbst nicht mehr geschlagen zu werden. Wenigstens für einen kurzen Moment.
Und in dieser Ecke hockte ich nun und dachte nach. War das wirklich würdelos, was ich tat? Darauf zu verzichten, meine Nahrung zwischen den Sträuchern, in den Bäumen und auf den Wiesen zu suchen, Raupen und Würmer zu zerkleinern und zu fressen, fliegende Insekten im Flug zu fangen und zu schlucken? Statt dessen stillte ich meinen Hunger mit dem, was die Menschen unter Fast food verstanden, eine Ernährungsform, die genausooft kritisiert wurde, wie sie zur Anwendung kam. Kein Wesen auf der Welt – und so jung ich noch war, das Menschsein kannte ich fast so gut wie das Vogelsein – stellte derart das eigene Handeln in Frage. Je grimmiger etwas hinterfragt wurde, um so lustvoller taten es die Leute. Eben auch auf der Straße essen anstatt zu Hause, wo es früher üblich gewesen war. Während sie jetzt überall stopften und kauten: im Stehen, im Gehen, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg in den Urlaub und somit auch, wenn sie auf einen Zug warteten. Sie warteten und aßen, oft mit den Händen, was auch dazu führte, daß vieles auf die Seite fiel – überall wurde gebröselt und gekleckert. Weshalb ich und meine Artgenossen sowie einiges andere Getier ja überhaupt erst auf die Idee gekommen waren, diese Möglichkeit zu nutzen. Ebenfalls Fast food zu uns zu nehmen, wobei wir Spatzen auf Grund unserer Geschwindigkeit und Wendigkeit viel eher als die Menschen dem Begriff des „schnellen Essens“ gerecht wurden.
War das ein Verbrechen? Ein Verrat an meiner Natur? War ich ein „schlechter“ Spatz, eine Schande für meine Rasse, verdorben, verkommen, eine fliegende Maus, so wie man sagt, Tauben seien fliegende Ratten? Oder müßte ich mir sogar gefallen lassen, „menschlich“ genannt zu werden, weil ich mein eigenes Handeln derart in Frage stellte? Und hätte es nicht genügt, ein bißchen über mich selbst zu schimpfen, kurz, ein schlechtes Gewissen zu haben, um danach recht vergnügt mit allem fortzufahren wie zuvor?
Aber genau das wollte nicht gelingen. Zu sehr klebte der verächtliche Blick des kleinen Mädchens auf meiner Seele. Ja, dieser Blick! Und da ich ihn noch immer spürte und er mir fortgesetzt weh tat, schien mir dies geradezu ein Beweis dafür, überhaupt so etwas wie eine Seele zu besitzen. Einen sensiblen Punkt in meinem Inneren, eine Art höchst empfindlichen Unterleib, so eine Stelle, wo sich Fußballer mit gutem Grund beim Freistoß immer die Hände vorhalten. Freilich ein Unterleib mit Hirn und darum noch sehr viel verletzlicher.
Der Blick des Mädchens bewirkte etwas in mir. Ich hatte ja noch immer das Stückchen Kruste im Schnabel, das mir eines der Kinder zugeworfen hatte und das ich – als sei ich ein gottverdammter Seelöwe, der im Zoo den Kasperl macht – aufgefangen hatte. – Ich spuckte es aus.
Das war sicher pathetisch, denn ich hätte das bißchen blätterigen Plunderteig ja schlucken und erst nachher beginnen können, mein Leben zu ändern. Aber das Pathos ist etwas, was zur Seele dazugehört. Das Pathos ist der Farbanstrich der Seele: ein buntes Kleid oder eine funkelnde Rüstung oder ein T-Shirt mit einem geilen Spruch drauf, in der Art von Fuck the Starlings.
Ich ließ den kleinen Bissen also fallen, stieß mich von der Kante meiner „Ringecke“ und flog durch die Halle hinunter ins Erdgeschoß, wo ich durch eine hohe Türe ins Freie glitt und sodann einen benachbarten kleinen Park ansteuerte, in dem ich bisher nur ein einziges Mal, und das sehr kurz, gewesen war. – Stimmt, über den Gleisen des Bahnhofs befindet sich eine durchaus üppige Grünfläche, die noch viel näher gelegen hätte, der Jardin Atlantique, wo ich aber auch nur einmal und nie wieder gewesen war. Bei diesem einen Mal hatte ich einen Alarmruf meiner Artgenossen nicht ernst genommen, war hocken geblieben und von einem ziemlich großen Vogel angegriffen worden; einem Monstervogel in meiner Erinnerung, auch wenn es wahrscheinlich nur ein Sperber gewesen war. Aber auch die sind reine Schlächter. Jedenfalls war ich knapp entkommen und hegte seither eine starke Aversion gegen diese Gartenanlage. Das Gefühl einer Wunde, sobald die Sprache darauf kam. Nein, dann schon lieber hinüber zum so viel kleineren Square Gaston Baty.
Freilich war ich kein ungebildeter Trottel, nur, weil ich in einem Bahnhof aufgewachsen war. Ich wußte sehr wohl ein längliches Stück Eichhörnchenkot von einem ähnlich langen und ähnlich dünnen Regenwurm zu unterscheiden. Doch als ich dann auf einem Ast saß und auf einen solchen angeblich sehr gesunden Wurm hinunterschaute – geradezu einen Biowurm, auch wenn die Erde, durch die er sich fraß, nicht ganz giftstofffrei sein mochte –, kam mir vor, er unterscheide sich von einem länglichen Stück Kot in erster Linie dadurch, eine Bewegung zu vollführen: ringelnde Scheiße zu sein. Und als ich nun abwärts flog, nahe neben ihm landete und es darum gegangen wäre, mit meinem Schnabel seinen schwabbeligen, aus einem einzigen Darm bestehenden Körper aufzupicken, da wurde mir übel. Nicht nur wegen des unappetitlichen Anblicks, sondern auch wegen der Vorstellung, es hier mit einem Zwitter zu tun zu haben, jemand, der praktisch Mann und Frau zugleich war. Wobei ich wohl ganz grundsätzlich ein Problem damit hatte, etwas Lebendiges zu töten. Letztlich fragte ich mich, ob Regenwürmer überhaupt zum sogenannten Speiseplan eines Sperlings gehörten. Denn ein Sperling war ich ja, was einfach ein anderes Wort für Spatz ist und etwas vornehmer klingt, wie es vornehmer klingt, einen Affen als Primaten zu bezeichnen oder einen Landesmeister als Staatsmeister, wie das die Österreicher tun, die ein Faible fürs Vornehme haben.
Insekten aber gehörten ganz sicher zu meinem Speiseplan. Und sie waren hier in großer Menge vorhanden. In der warmen Parkluft schwirrten sie umher wie Fischfutter in einem Aquarium. Es wäre ein leichtes gewesen, sich eins von ihnen zu angeln. Doch auch davor scheute ich mich. Ich scheute mich, eine x-beliebige Mücke praktisch abzustechen. Ich empfand einen Widerwillen gegen das Töten, aber nicht, weil ich das Töten als solches ablehnte, welches ja ganz sicher zu einem normalen Leben dazugehörte. Die Natur hatte es so eingerichtet, daß allerorts getötet wurde. Daran konnte nichts Falsches sein, sowenig es falsch war, daß es im Winter kalt wurde, auch wenn man vom Standpunkt eines Vogels, der kein Zugvogel war, wenig Freude daran hatte. Nein, mein Widerwille galt dem Akt als solchem, etwas zu essen, was noch lebte oder eben erst durch mich gestorben war. Anstatt es zu begraben oder – noch besser – einfach in Frieden zu lassen. Das Töten mochte moralisch in Ordnung gehen, häßlich war es dennoch.
„Alles ist eine Frage der Gewohnheit“, hatte ich einmal einen älteren Spatzen reden hören. Da war es freilich darum gegangen, daß seit einiger Zeit das Baguette an einem bestimmten Stand so anders schmeckte. Allerdings schien dieser Satz für fast sämtliche Dinge des Lebens zu gelten.
Ich pickte schneller zu, als ich denken konnte. Ich hielt die kleine Mücke für einen Moment zwischen den Teilen meines Schnabels, verhinderte ihre Flucht, registrierte ihre heftigen Bewegungen. Als sie tiefer in meinen Schlund geriet, spürte es sich an, als rotiere dort eine winzige Schlittschuhläuferin. Ihr Sterben kitzelte mich. Endlich schluckte ich sie hinunter.
Und wozu das Ganze? Um schlechter zu essen, mich aber besser zu fühlen? Mich für einen „echten“ Sperling halten zu dürfen?
Übrigens, es versteht sich, daß ich in diesem Park ebensowenig der einzige Spatz war wie im Bahnhof. Die Spatzen wie die Menschen treten gerne in Massen auf, was wissenschaftlich als „gesellig“ bezeichnet wird. Auch so ein vornehmes Wort, welches erklärt, daß jemand nicht alleine zu sein braucht. Wie schön es sein kann, sich zu drängen.
Allerdings war ich hier – obgleich nahe dem Bahnhof – bereits ein Fremdling. Nicht, daß man mich attackierte oder zu verjagen versuchte, aber man machte einen Bogen um meine Person, wodurch in meiner unmittelbaren Umgebung das Gedränge ein geringeres war. Vielleicht hing es einfach mit meinem Geruch zusammen. Vielleicht duftete ich zu sehr nach Bäckerei und Imbißstube und Frittierfett und Cola.
Keine Frage, auch im Park mußte man sich nicht unbedingt von tierischer Beute ernähren, immerhin gab es Gräser und Samen, und auch hier saßen die daueressenden Menschen auf Parkbänken und verstreuten mit oder ohne Absicht kleine Stücke ihrer belegten Brote und gefüllten Fladen. Es war jetzt Mittagszeit und sämtliche Plätze besetzt. Mehrere Sperlingsgruppen umtanzten die Bänke und bewiesen in Konkurrenz mit anderen Vögeln ihr Geschick.
Ich probierte gar nicht erst, mich einem Schwarm anzuschließen. Flog statt dessen auf einen Ast hoch, sozusagen meine eigene Parkbank, und gab mich einem Gefühl der Traurigkeit hin. Mir war melancholisch zumute.
Wie alt war ich jetzt? Etwa ein dreiviertel Jahr?
Und wie alt würde ich werden können? Zwei Jahre, drei Jahre? Immerhin hatte ich die gefährlichste Phase bereits hinter mir. Leider bedeutete in der Stadt zu leben nicht gerade, ohne Bedrohung zu sein. Allein, wenn man den Verkehr bedachte. Und die Krankheiten. Weiter draußen wäre es gesünder gewesen, in den Vorstädten, von denen ich viel Gutes gehört hatte, allerdings auch, daß dort Katzen lebten. Ich hatte noch nie eine gesehen. Eichhörnchen, Marder, sogar Falken, das schon, aber noch nie eine Katze. Ich kannte Katzen nur aus der Werbung. Aus der Werbung für Katzenfutter. Als Bahnhofsspatz konsumierte ich viel Werbung, zudem Nachrichten, kurze Filme, wechselnde Plakate. Sport, Politik, Erregungen. Und hatte mich oft gefragt, wieso es keine Werbung für Spatzenfutter gab. Wieso waren Katzen den Menschen so lieb, obwohl sie doch als besonders geschickte Mörder galten? Oder war es etwa so, daß die Menschen genau darum die Katzen fütterten, damit sich das Morden an uns Vögeln in Grenzen hielt?
Das Verhältnis zu uns Spatzen wirkte ungleich schwieriger. Zwar gab es den Begriff „süßer Spatz“, so wie es Leute gab, die uns fütterten, doch die, die das ausgiebig taten, wirkten merkwürdig, als gehörten sie nicht wirklich zu den Menschen, zumindest nicht zu den normalen. Einmal hatte ich etwas gelesen wie: „Spatzen vertreiben – so werden Sie die Vögel los.“ Auch das war eine Art Werbung gewesen. Unvorstellbar hingegen, daß irgendwo gestanden hätte: „Katzen vertreiben – so werden Sie die Katzen los.“
Die Katzen, Mörder hin oder her, schienen ganz zu den Menschen zu gehören, die Spatzen nicht.
Wollte ich überhaupt zu den Menschen gehören? Eigentlich schon. Ich war ja in ihrer Nähe aufgewachsen, in einem Nest im Dach des Bahnhofs. Ich war immer von ihnen fasziniert gewesen, nicht zuletzt davon, wie alt sie werden konnten. Achtzig, neunzig, manche sogar hundert Jahre. Das war gewaltig im Vergleich zu Spatzen, von denen viele im Kindes- oder Jugendalter starben, und auch die Erwachsenen wurden kaum mehr als ein paar Jahre alt. Angeblich gab es auch Ältere, sogar richtig Uralte, doch die mußten sich das hohe Alter mit Gefangenschaft erkaufen. Es waren jene, die in einem Käfig lebten. Ansonsten aber …
War das gerecht?
„Sei froh“, erklärte mir einmal ein älterer Spatz, „daß du keine Fliege bist, dann wär’s schon nach ein paar Wochen aus mit dir.“ – Das war typisch für die Alten, der Verweis darauf, es hätte auch noch schlechter sein können. Was allgemein als Weisheit galt. Altersweisheit. Wenn es kalt war, sagten sie, es könnte auch kälter sein. Wenn die Hitze schlimm wurde, erzählten sie sich Geschichten von katastrophalen Jahrhundertsommern aus früherer Zeit. Wenn ein Junges seine Eltern verlor, sagten sie, daß jene Kinder, die von Zieheltern aufgezogen wurden, letztlich zu den Stärksten und Klügsten zählten. Als wäre es nicht besser, weniger stark und nicht ganz so klug zu sein und dafür seine Eltern zu behalten. Oder?
Obgleich ich mich an die eigenen gar nicht mehr so richtig erinnern konnte. Doch da war ein Gefühl, ein warmes. Ein Nestgefühl eben. Wäre ich jetzt meinen Eltern begegnet, ich glaube, ich hätte sie dennoch wiedererkannt. Nicht das Gefieder, nicht die Form des Schnabels, nicht einmal ihre Stimmen, sondern … ich glaube, ich hätte sie an ihrer Zweisamkeit erkannt, an ihrer Liebe zueinander. Einer Liebe, in die wir Kinder für eine kurze Zeit eingebunden gewesen waren. – Man kann sicher sagen, daß Spatzen ziemlich gut in der Liebe sind.
Aber eben schlecht im Altern. Und genau dieser Umstand quälte mich in diesem Moment. Ich weiß schon, daß gerade unter den Menschen viele meinen, man müsse sich mit der eigenen Lebenserwartung abfinden, alles andere sei töricht, wenn nicht gottlos, aber so zu denken ist halt sehr viel leichter, wenn man eine Riesenschildkröte ist oder so ein Fisch mit dem Namen Koi oder eben ein Mensch.
Deprimiert ob meiner Altersaussichten, deprimiert ob meiner Unfähigkeit, mit Genuß einen Wurm, eine Fliege, eine Raupe oder einen Käfer zu verspeisen, verfiel ich weiter in Schwermut. Schwermut ist ein Zustand, in dem man paradoxerweise die Dinge des Lebens durch den Schleier der eigenen Traurigkeit sieht, das aber ungemein klar und deutlich. Als würde man ausgerechnet beim Blick durch ein Glas naturtrüben Apfelsafts die Welt besser erkennen als je zuvor.
Die Zeit verging, der Mittag drehte sich wie eine Schraube in den Nachmittag und machte ihn fest.
Doch dann geschah etwas. Und die Art und Weise, wie es geschah, kratzte an meiner Vorstellung, wie sehr alles im Leben ein Zufall sei. Ich will jetzt nicht sagen, die folgenden Erlebnisse hätten mich dazu verführt, direkt an einen Gott zu glauben, gleich ob Spatz oder Mensch, aber doch an einen Plan, an ein Schicksal, das seine Finger im Spiel hat und das nicht so blind ist, wie ich bis dahin angenommen hatte. Das weiß, was es tut und vor allem wieso. Nicht immer, mag sein, weil eben ein solches wegweisendes Schicksal nicht überall und zu jeder Zeit sein kann, aber doch in entscheidenden, eine Geschichte verursachenden Momenten.
Es ist eine Sache, wenn einem ein Ding auf den Kopf fällt, etwa ein Wassertropfen oder ein Blatt, ein Modellflugzeug, eine Frisbeescheibe, vielleicht sogar ein Ziegelstein, das alles ist unangenehm oder sogar lebensgefährlich, es ist echt bad luck, aber es hat nichts zu bedeuten. Manche von uns sind in der Tat Opfer gänzlich ungeplanter Vorfälle.
Eine ganz andere Sache hingegen ist, wenn du, der du ein Spatz bist, auf einem Ast hockst und von einem anderen Spatzen getroffen wirst. Damit ist kein Zusammenstoß in der Luft gemeint, nein, was in diesem Moment allen Ernstes geschah, war, daß ein seiner Flugfähigkeit beraubter Haussperling aus dem Himmel stürzte und zentimetergenau auf meinen Schädel auftraf, mich dadurch vom Ast riß, so daß wir zusammen hinunter auf die Erde fielen.
Als ich aus kurzer Betäubung hochschreckte, bemerkte ich das viele Blut. Unrealistisch viel Blut für einen bloßen Sturz, der ja nicht ungebremst gewesen war, denn natürlich hatte ich meine Flügel eingesetzt, nichts war gebrochen, nichts verletzt. Aber es war auch nicht mein eigenes Blut, sondern das des Artgenossen, der auf mir gelandet war und jetzt zu meinen Füßen auf dem gepreßten Lehmboden lag. Er blutete aus zwei Stellen seines Körpers. Das konnte nie und nimmer vom Aufprall stammen. Offensichtlich war er angeschossen worden. Beziehungsweise waren die Kugeln oder Pfeile durch seinen Körper gedrungen, vorne rein und hinten raus, kleine Kugeln oder kleine Pfeile, weil größere hätten ihn völlig zerfetzt. Doch todbringend würden sie trotzdem sein. Daß der Getroffene noch immer atmete, war ein Wunder. Und eine Frage des Willens, denn auch Wunder mußten erzwungen werden. Dieser stark verwundete Spatz wehrte sich gegen den unvermeidlichen Tod. Er war das, was die Menschen einen Helden nannten.
Und was war ich dabei? Welche Rolle spielte ich? War ich der Außenseiter, der im wahrsten Sinne kleine Spatz? Auf den jedoch das Schicksal mit dem Finger gezeigt und erklärt hatte: „Der da! Den holen wir rein in die Geschichte. Damit wir eine Figur aus dem Volk haben.“
So kam es mir vor, als ich mich jetzt zu dem Sterbenden hinunterbeugte, dessen Augen hinter den engen Lidspalten fern glänzten, so, als würden diese Augen schon eher ins Jenseits als ins Diesseits schauen. Seine Stimme jedoch war auf mich gerichtet, schwach, die Worte deutlich. Deutlich und von jener Art, wie Spatzen sprechen, die von der Welt mehr gesehen haben als einen Vorgarten oder den Freiluftbereich eines McDonald’s. Gewählt und gebildet, obgleich er gerade am Sterben war. Auch klang es, als rede er durch die Löcher oberhalb seines Schnabels, als er jetzt sagte: „Der Tod wartet auf mich, mein Junge. Ich kann ihn sehen, den Tod, und so wie er dreinschaut, merke ich eine gewisse Ungeduld. Wir müssen uns also beeilen.“
Wenn einer so redet … Ich meine, ein normaler Spatz hätte gesagt: „Verdammt, ich sterbe!“ oder „Wär ich bloß im Nest geblieben.“ Darum begriff ich jetzt, mit wem ich es zu tun hatte. Mit einem Menschenspatzen. Was weder den Begriff des Menschenaffen imitiert, noch ein Hinweis darauf ist, daß ein Spatz anstelle eines Kanarienvogels in einem hübsch dekorierten Käfig sitzt und eine freundliche alte Dame anzwitschert. Nein, das Wort „Menschenspatz“ bedeutet, daß ein solcher Spatz tatsächlich im Dienst eines Menschen steht. Eines Menschen oder einer Firma.
Auch wenn denkende, intelligente Vögel für die meisten Menschen nur im Märchen vorkommen, hatte vor allem das Militär schon vor langer Zeit die Möglichkeiten erkannt, sich gefiederter Helfer zu bedienen. Offensichtlich stehen Leute, deren Beruf es ist, Krieg zu führen, den Geheimnissen des Lebens sehr viel offener gegenüber als die, die sich mit dem Frieden zufriedengeben. Bereits im Mittelalter herrschte die Praxis, Spatzen einzusetzen, deren Flugleistungen und vor allem Flugdistanzen weitaus größer sein können, als in den Lehrbüchern beschrieben. Aber das Entscheidende war und ist etwas anderes: wie gut nämlich Spatzen verstehen, was Menschen sagen. Sie verstehen jedes Wort, auch wenn nicht alle jedes Wort auch begreifen. Einige Menschen wissen darum. Darum werden Spatzen rekrutiert. Zur Nachrichtenüberbringung, zur Sabotage, zur Spionage, auch zum Transport winziger, aber effektiver Sprengkörper, ja sogar zur Tötung, indem sie Giftnadeln in die Körper von Zielpersonen befördern. Wer auch könnte eine Bedrohung ahnen, wenn statt eines Kampfflugzeugs ein Spatz vorbeifliegt? Nur jene Leute, die selbst Spatzen beschäftigen, werden nervös, sobald sie unter Spatzen geraten.
Auch wenn meinesgleichen also die menschliche Sprache versteht, sind wir selbstverständlich außerstande, wie Menschen zu sprechen. Das wäre dann wirklich wie im Märchen oder in einer Kinokomödie. Nein, Spatzen sind Singvögel, singen also, beziehungsweise praktizieren ein getrillertes Rufen, wobei es sich um ziemlich komplexe und textlastige Rufe handelt, die zu entschlüsseln den Menschen nie gelang und nie gelingen wird. Darum ging man den umgekehrten Weg und begann, Systeme der Übertragung zu entwickeln. Anfänglich eine Art von Morsen, während heutzutage Tastaturen und tastempfindliche Bildschirme zum Einsatz gebracht werden. Der Spatz schreibt mit seinem Schnabel mindestens so schnell wie ein Mensch mit seinem Zehnfingersystem. Und die Beherrschung von Rechtschreibung und Zeichensetzung ist durchaus erlernbar. – Die meisten Spatzen setzen mehr Beistriche als die meisten Menschen.
Wenn jetzt jemand wissen will, wieso die Intelligenz und die Möglichkeiten der Sperlinge nicht allgemein bekannt sind, dann muß ich entgegnen: Was für eine naive Frage! Denn schließlich stehen solche Spatzen im Dienste diverser Geheimdienste, der Militärs, der Agenten weltbeherrschender Konzerne, und dort hat niemand Interesse daran, daß ein Sperlingsvogel von der Art Passer domesticus im französischen oder deutschen Fernsehen oder sonstwo auftritt und – ich sag mal – ein Gedicht von Baudelaire oder einen supergescheiten Satz von André Glucksmann auf einen Bildschirm hinpickt oder vor aller Augen eine Bombe entschärft. Oder eine wirft.
Können alle Spatzen schreiben?
Nein, natürlich nicht. Allerdings können alle lesen, was sicher mysteriös ist, diese so gut wie angeborene Fähigkeit, den Menschen zu verstehen und eben auch das Geschriebene zu begreifen, jedoch nicht in der Lage zu sein, die menschliche Schrift einzusetzen. Dies beherrschen nur jene Spatzen, die sich auf die Menschen eingelassen haben oder das Pech hatten, gefangen zu werden. Ein Menschenspatz ist immer auch ein unfreier Spatz. Mag sein, daß er die beste Nahrung erhält, das beste Training, vor allem natürlich das Schreiben und das Kämpfen betreffend, aber er ist unfrei. Es gibt immer etwas, mit dem man ihn zwingen kann, weiter für seine Dienstherren zu arbeiten. Herren, die auf die perfide Idee kamen, den von ihnen rekrutierten Spatzen winzige Geräte einzubauen, die per Signal Schmerzen bereiten. Zuerst Schmerzen. Und wenn die Schmerzen nicht fruchten: Wunden.
Wunden wie diese beiden hier, das wurde mir jetzt klar. Keine Kugeln, keine Pfeile hatten das verursacht, sondern ferngesteuert zum Platzen gebrachte Stellen im Körper des Spatzen. Welcher sich offensichtlich dem Signal zur Rückkehr widersetzt und trotz größter Qualen einen Befehl verweigert hatte. Und darum nun sterben mußte.
Während er schwächer wurde, sagte er: „Fahr nach Wien.“
Ach ja, dachte ich mir, da bin ich ohnehin noch nie gewesen.
Das war natürlich ironisch gedacht, weil ich überhaupt noch nie irgendwo gewesen war außerhalb eines Radius von ein paar hundert Metern um den Bahnhof. Ich war noch nicht mal so richtig hoch geflogen. Bereits den Eiffelturm kannte ich nur vom Hörensagen. Und jetzt sollte ich also so einfach nach Wien fahren. Ha!
„Na, einfach wahrscheinlich nicht. Aber fahren wirst du trotzdem.“ Das hatte nicht der Menschenspatz zu mir gesagt, sondern meine innere Stimme. Sie meldete sich ab und zu. Sie war recht tief und klang so, als würde da ein sehr viel älterer, sehr viel größerer Vogel sprechen, etwa ein Albatros. Diese Stimme hörte nicht auf, mir fremd zu sein, trotzdem stammte sie aus meinem Inneren und war folglich nicht abzustellen. Hätte ich mir also die Ohren zuhalten können, hätte das auch nichts genutzt. Die innere Stimme kam und ging, wie es ihr paßte. Ein Albatros in meinem Kopf.
„Warum Wien?“ fragte ich den sterbenden Sperling.
Der aber sagte: „Geh zu Pinesits.“
„Den gibt es doch gar nicht wirklich!“
„Und ob es den gibt.“
Pinesits! Ein Name, wie wenn eine Tüte mit Walnüssen aufplatzt und ihren Inhalt freigibt. Und zwar einer ewigen, sich stets aufs neue füllenden, sich schließenden und wieder öffnenden Tüte, eingedenk dessen, daß Pinesits als der Älteste aller bekannten Spatzen galt. Wobei ich freilich niemals geglaubt hatte, er würde tatsächlich existieren. Außer als erfundene Figur, damit die Kleinen was zum Einschlafen und Träumen haben.
Doch der sterbende Spatz bestand darauf, mich nach Wien zu schicken, um dort Pinesits aufzusuchen und ihm eine Nachricht zu überbringen, nur ihm persönlich.
„Was für eine Nachricht?“
„Daß ein Angriff bevorsteht“, antwortete er. „Sag Pinesits, daß er die Sperkkrieger warnen muß.“
„Sperks, im Ernst? Und warnen wovor?“
„Ich sterbe“, sagte der Menschenspatz, „und du redest immer dazwischen.“
Da hatte er recht. Ich nickte.
Er nahm noch einmal alle Kraft zusammen und setzte fort, mir zu erklären, hier in Paris befinde sich die Zentrale eines Konzerns mit dem Namen Facette Totale. Intern nannten sich diese Leute „Totalisten“. Leute, für die er arbeite, seit er denken könne. Er sei dort aufgewachsen, zuerst als Versuchstier, später als Bote und Spion. Allerdings war er vor kurzem in die Fänge eines konkurrierenden Unternehmens geraten und hatte sein Leben nur retten können, indem er auch diesen Leuten seine Dienste anbot. So sei er zum Doppelagenten geworden. Und als solcher habe er ein Gespräch der Totalisten abgehört. Ein Gespräch von größter Bedeutung. Eines, das er aus guten Gründen nicht an seine neuen Dienstherren weitergegeben habe.
„An die nicht“, sagte er. „Aber an dich.“
So erfuhr ich, daß es den Totalisten nach langer Suche mit Hilfe ihrer Satelliten gelungen war, das Hauptquartier der legendären Sperks ausfindig zu machen. Leider waren bei diesem Gespräch, das der Menschenspatz belauscht hatte, weder der Name des Ortes noch seine Koordinaten gefallen, allein ein Begriff, der einen Code darstellen mußte, nämlich Dezember. Es war definitiv nicht der Monat gemeint, sondern jene geheime Stelle, an die sich die Sperkkrieger zurückgezogen hatten.
Sperks also. Europäische Hausspatzen, die sich vor einigen Generationen entschieden hatten, einen dritten Weg zu wählen neben der Lebensweise der Menschensperlinge und jener der durchschnittlichen Stadt- und Landspatzen. Eine Kaste von Kriegern, die eine neue Kultur gegründet hatten sowie einen eigenen Staat.
Stimmt, ich hatte das Ganze bisher für eine Erfindung gehalten, eine Sage, eine Fantasygeschichte, genau so wie eben auch die Existenz eines in Wien lebenden Uraltspatzen namens Pinesits. Mein Gott, wer glaubt schon ernsthaft an so etwas?
Klar, für einen gewöhnlichen erwachsenen Menschen klingt bereits die Vorstellung von Spatzen, die über die Frage nachdenken, ob eher Fast food oder Naturessen zu bevorzugen sei, ziemlich phantastisch, wenn nicht absurd. Und doch gibt es solche Spatzen. Wer wüßte das besser als ich?
Das Interessante an den Sperks war – und genau dies war für die Totalisten essentiell –, daß sie für sich selbst eine Rüstung entwickelt hatten. Eine Rüstung, die ihren ganzen Körper bedeckte.
Klar, Rüstung und Krieger, das gehört eigentlich zusammen. Doch wie hatte man sich eine solide Schutzkleidung bei einem Wesen vorzustellen, das um die dreißig Gramm wiegt und dessen Überleben nicht unwesentlich davon abhängt, in die Luft gehen zu können? Ein Spatz mit Rüstung, das hört sich an wie ein Fisch mit Betonflossen. Doch angeblich war es den Sperks gelungen, ein Material herzustellen (oder aber sie hatten das Material als mysteriöses Geschenk empfangen), das die Eigenschaften einer ultraharten Kohlenstoffform mit extremster Leichtigkeit verbindet, man könnte sagen: fester als fest und leichter als leicht, leichter als Luft, zudem stabil und elastisch. Widerstandsfähiger und gewichtsärmer als sämtliche von Menschenhand hergestellten Feststoffe. Angeblich. Und angeblich träumten die Totalisten schon lange davon, mittels eines solchen Materials auch menschlichen Kriegern eine zauberisch anmutende Unverletzbarkeit bei gleichzeitig fabelhafter Beweglichkeit angedeihen zu lassen. Einen Anzug zu fertigen, der als Siegfried completed den modernen Krieg revolutionieren sollte. Oder was sich mit diesem exotischen Material sonst noch so alles produzieren ließe.
Ein Material, dem die Totalisten den Namen Feathers gaben wegen jener winzigen Einschlüsse in Diamanten in Gestalt einer Feder.
Der tödlich verwundete Spatz zu meinen Füßen sagte: „Totalisten sind definitiv keine Tierfreunde. Jetzt, wo sie wissen, wo die Sperks leben, werden sie dort auftauchen, aber kaum, um ein Geschäft anzubieten. Wenn sie erklären: Wir kommen in Frieden, dann ist’s eine Falle. Nein, die Sperks müssen gewarnt werden.“
Ich dachte mir, daß es den Totalisten doch eigentlich genügen müßte, in den Besitz einer einzigen Rüstung zu gelangen, um den Stoff analysieren zu können. Andererseits konnte man die Rasse Mensch ganz gut dadurch definieren, indem man sie – im Gegensatz zur Rüstung der Sperks – als sowohl superweich wie auch ultraschwer bezeichnete. Vor allem in charakterlichem Sinn. Dieser Mischung war zu verdanken, daß sie so gerne Dinge unter Schutz stellten, die sie gleichzeitig ausrotteten. Man konnte nie wissen, ob sie einen demnächst füttern oder vergiften würden.
Ich beugte mich noch tiefer zu dem Sterbenden. Das glänzende Schwarz seiner Augenschlitze erschien mir jetzt als das Entfernteste, was ich je gesehen hatte. Lichtjahre, aber ohne Licht. Ich fragte ihn: „Und wo finde ich Pinesits?“ Und fügte an: „So klein ist Wien ja auch wieder nicht.“
„Er lebt bei einem gewissen Engel.“
„Wie bitte?“
„Der Mann heißt Engel. Er ist keiner, er heißt nur so. Arthur Engel.“
Der Menschenspatz erzählte mir jetzt mit der Atemlosigkeit eines vom Tode Gehetzten: „Es wird gesagt, man könne von Pinesits’ Fenster auf einen Friedhof schauen. Einen Friedhof am Rande von Wien. Wo in der Mitte ein großer goldener Christus an ein Kreuz genagelt ist.“
Weil ich um die Masse der Friedhöfe und Christusse auf dem ganzen Kontinent wußte, fand ich das ziemlich unpräzise. Aber der Menschenspatz erklärte mir: „Mehr kann ich nicht sagen. Und weiß ja auch nicht, wo das Quartier der Sperks liegt. Pinesits aber schon. Er ist der einzige, der die Sperks warnen kann. Er ist unser aller Wissen und Gewissen.“
Ich meinte: „Die werden dort in Wien doch auch Telefone haben, oder?“
Der verwundete Menschenspatz überhörte meinen Sarkasmus, denn selbstverständlich war uns Spatzen dieser Kommunikationsweg verwehrt.
Ihm blieben nur noch wenige Sekunden. Er verlangte: „Versprich mir, nach Wien zu fahren und ihn zu suchen.“
„Warum ich?“ wollte ich mich erkundigen. Aber das wäre überflüssig gewesen. Ich hatte nun mal im entscheidenden Moment auf dem Ast gesessen, nicht irgendwo, sondern millimetergenau an der Stelle, an die ein lenkendes Schicksal mich geführt hatte. Weder würde ich diesen Auftrag einfach vergessen noch ihn an jemand anders weitergeben können. Keine Frage, ich mußte hier und jetzt schwören. Und sagte darum: „Okay, versprochen, ich schaue, wie ich nach Wien komme, und falls ich das wirklich schaffe, werde ich Pinesits suchen und …“
Die Augen des Blutenden schlossen sich, sein Kopf glitt zur Seite, sein Herz blieb stehen, und sein Atem verrauchte gleich einer kleinen Wolke aus drei Buchstaben: S O S.
Ich hatte das Bedürfnis, etwas zu sagen, so wie die Menschen sagen: Ruhe sanft! Ich flüsterte: „Schlaf schön!“
Sodann richtete ich mich wieder auf und überlegte, was zu tun war. Ob ich jemand ins Vertrauen ziehen sollte. Einen der anderen Spatzen. Einen Freund. Allerdings war da niemand, den ich ernsthaft als meinen Freund hätte bezeichnen können. Kollegen, Kameraden, Typen, die zusammen eine Gang bildeten, das schon, aber kein Freund. Und für eine Gefährtin war ich noch zu jung. Ich wußte, daß ich in einigen Monaten nicht mehr zu jung wäre und in der Folge eine Menge Theater aufführen würde, um an ein Weibchen zu gelangen. Was ein merkwürdiges Gefühl war. Wie wenn man sagt: „Ich mag nicht schwimmen gehen, ich mag nicht naß werden, aber ich ahne, daß ich spätestens in einem halben Jahr wie ein Verrückter – mit dem Kopf voran und Salto und zig Schrauben – ins Wasser springen und mit Freude untergehen werde.“
Jetzt aber war ich allein. Allein mit diesem Auftrag, in eine Stadt zu fahren, von der ich nur den Namen und ein paar Klischees kannte. Etwa, daß dort wahnsinnig viel Hundedreck lag und sich die Menschen auch schon zu Lebzeiten am liebsten auf Friedhöfen aufhielten. Passend also, daß dieser Mann, der Engel hieß, ein Haus bewohnte, von dem aus man einen Blick auf einen „Grabsteinpark“ hatte. Sowie auf einen goldenen Christus.
Während ich noch überlegte, wie man am schnellsten nach Wien kam und wo Wien überhaupt lag, bemerkte ich zwei Männer, die sich näherten. Auch sie ein Klischee verkörpernd, in ihren schwarzen Anzügen und mit Sonnenbrillen. Selbst wenn man die Apparaturen nicht gleich sah, die ihnen da im Ohr steckten, ihre typische Kopfhaltung war unverkennbar, so, als müßten sie nicht bloß ein System aus Knopf im Ohr und schultergebundenem Mikrophon tragen, sondern ein ganzes Storchennest auf ihrem Scheitel balancieren. Und auf dem Storchennest eine Satellitenschüssel.
Agenten!
Ich hüpfte ein paar Meter zurück und pickte am Boden herum, um mich „spatzenhaft normal“ zu geben. Lugte aber hinüber zu den zwei dunkel Bebrillten, die neben dem toten Menschenspatzen zum Halten kamen. Einer kniete sich hin. Er trug trotz der Wärme Handschuhe, griff damit nach dem leblosen Körper, tütete ihn in eine durchsichtige Hülle ein und steckte diese wiederum in die Tasche seines Jacketts. Wäre jetzt ein Polizist gekommen und hätte ihn kontrolliert … Wie hätte er die Vogelleiche in seiner Tasche erklärt? Aber da kam kein Polizist, nur eine ältere Frau schaute herüber. Die zwei Männer drehten sich rasch in die Richtung, aus der sie gekommen waren, und gingen davon.
Hätte ich noch einen Beweis benötigt, um diese Geschichte ernst zu nehmen, hier hatte ich ihn.
Einen Beweis und ein Versprechen.
Paris–Wien also!
Fliegen kam nicht in Frage. Weder aus eigener Kraft, denn dafür wäre die Distanz sicherlich zu groß gewesen, noch wollte ich zum Flughafen, um mich in ein Flugzeug zu schwindeln. Ich war ein Bahnhofsvogel. Es war nur natürlich, einen Zug zu nehmen.
Wir hatten im Bahnhof einen älteren Spatzen, der alle Zugverbindungen im Kopf hatte. Nicht, weil ihm das irgendwas gebracht hätte. Er war noch nie gereist, keinen einzigen Kilometer. Nein, das mit den Zeiten und den Zahlen war ein Zwang bei ihm. Er besaß ein unglaubliches Gedächtnis und füllte es, so gut er konnte. Je mehr Daten, um so besser. Wobei ich nicht wußte, wie er an all diese Informationen gelangte, nicht allein die Abfahrts- und Ankunftszeiten auf dem Gare Montparnasse kannte, sondern auch die von allen anderen großen Bahnhöfen. Zudem hatte er den vollständigen Plan der Pariser Metro im Kopf und konnte einem sämtliche Verbindungen nennen. Uns anderen erschien sein Wissen grandios, aber ohne jeden Sinn, eine geniale Idiotie. Allerdings hatte ich einmal das Gerücht vernommen, es gebe Menschenspatzen, die ihn zu Rate zogen.
Ich hob ab und flog zurück in den Bahnhof, um das „Superhirn“ aufzusuchen. Dabei pickte ich von einem der Restauranttische einen Krümel auf, den ich dem alten Spatzen, der wie ein gefiederter Computer in einer Nische hockte und Zugzeiten vor sich hersagte, in den Schnabel steckte.
Er zerkleinerte das Teil, schluckte es hinunter und fragte: „Was willst du?“
„Den Zug nach Wien.“
„Was glaubst du denn, Junge? Von hier aus direkt dorthin zu kommen?“
„Keine Ahnung. Darum frage ich Sie ja, weil ich es nicht weiß.“
„Werd nicht frech.“
„Tschuldigung.“
Er überlegte. Wobei ich nicht glaubte, daß er über die Zugverbindung nachdachte, denn die war in dem Moment, als ich „Wien“ gesagt hatte, praktisch in seinem Kopf aufgeleuchtet, in Windeseile. Nein, er überlegte, ob er mir überhaupt helfen sollte. Er fragte: „Willst du mich testen, Kleiner?“
„Nein, ich muß wirklich nach Wien. Ein Auftrag.“
„Das ist doch ein Scherz, oder?“
„Kein Scherz“, versicherte ich. „Ich würde noch gerne heute fahren. Besser gesagt: ich muß.“
Er lachte verächtlich. Wie Politiker, wenn gerade ihre Kontrahenten sprechen (im Bahnhof gab es überall Fernseher, ich wußte um die politische Debatte und um die vielfältigen Formen des Grimassenschneidens). Aber ich hatte nicht vor, aufzugeben. Ich versuchte es mit einer Provokation, indem ich erklärte: „Na, vielleicht wollen Sie sich bloß ein bißchen Zeit verschaffen, um länger nachdenken zu können.“
Er mochte ja ein Genie sein, aber ein ziemlich durchschaubares. Sofort öffnete er seinen dunklen Schnabel und sprach im Schnellton: „Also erstens, du kleiner Depp, bist du am falschen Bahnhof. Du mußt zum Gare de Lyon. Zwar könntest du auch einen Zug vom Gare de l’Est nehmen, aber da müßtest du um diese Uhrzeit lange warten. Die nächste gute Verbindung ist die um 18 Uhr 15 vom Gare de Lyon nach Zürich, und dort steigst du um 22 Uhr 40 in den Nachtzug, dann bist du am Morgen in Wien. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie du das schaffst, aber die Zeiten stimmen hundertprozentig, da kannst du Gift drauf nehmen.“
„Gift?“
„Laß mich endlich in Frieden, Kleiner. Ich habe nachzudenken.“
Ich wollte aber noch wissen, wie man zum Gare de Lyon kam.
Erneut lachte er in der unguten Art und sagte: „Flieg doch, du Vogel!“
„Selber Vogel!“ dachte ich, bat ihn jedoch höflich, mir ein letztes Mal zu helfen.
Ohne mich noch einmal anzuschauen, erklärte er: „Die 6 bis Bercy und dann eine Station mit der 14 Richtung St. Lazare. Und jetzt zisch endlich ab.“
Ich dankte, schraubte mich hoch und ließ mich sodann Richtung Metro fallen, als sei ich ein kleiner Komet.
2
Mit der Metro unterwegs zu sein war nicht wirklich schwierig. Niemand von den Erwachsenen bemerkte einen mit der Bahn fahrenden Spatzen, der irgendwo oben saß, auf einer Stange oder einem unbesetzten Griff. Die Leute schauten immer gerade nach vorn oder hatten den Blick zum Boden gerichtet, oder sie klebten mit ihren Nasen an den kleinen Fenstern in ihren Händen. Die wenigen, die hochsahen, schliefen mit offenen Augen. Während wiederum kleine Kinder, die mich entdeckten – also die, deren Nasen noch zu jung waren, um sich an den Aussichtsscheiben von Telefonen zu reiben –, mich anlächelten oder interessiert den Kopf zur Seite legten. So, als würden sie eine erstaunliche Zeichnung betrachten. Ich hatte einmal gehört, Kinder seien sogar in der Lage, Engel wahrzunehmen. Was mir selbst noch nie gelungen war. Allerdings hatte ich so eine gewisse Ahnung, wobei ich nicht wußte, ob die Ahnung einfach auf Wunschdenken beruhte. Wie der Glaube an ein Jenseits. Allerdings mochte das auch für jene gelten, die an gar nichts glaubten. Die sich einfach wünschten, die Welt sei nichts anderes als eine perfekte, aber letztlich sinnlose Rechnung. Auch Logik war vielleicht nur ein Wunsch.
Immerhin, ich war soeben auf dem Weg zu jemand, der zumindest Engel hieß. Und Arthur dazu. Während ich selbst mich mit einem einzigen Namen begnügen mußte. Quimp und sonst nichts. Um sich als Spatz einen zweiten Namen zu verdienen, einen Nach- oder Beinamen, mußte man etwas Besonderes leisten. Bei den richtig alten Altspatzen allerdings, den lebenden Legenden wie Pinesits, genügte wiederum ein einziger Name. Sperks dagegen, so hatte ich gehört, hatten fast alle zwei oder drei Namen, weshalb die Geschichten, die über sie erzählt wurden, immer ein wenig kompliziert klangen. Da hieß es dann etwa, der Sowieso-von-Sowieso-Sperk habe sich mit einem Sowieso-van-der-Sowieso-Sperk duelliert. Für solche Berichte war es nötig, ein gutes Gedächtnis zu besitzen, ein wenig wie unser Superhirn.
Gemäß der Anweisung ebendieses Superhirns wechselte ich nun an der Station Bercy die U-Bahn und fuhr mit der 14 eine Station weiter zum Gare de Lyon, verließ den Wagen und flog mit jenen Passanten mit, die Koffer hinter sich herzogen. – Um ehrlich zu sein, einen Koffer hätte ich auch gern besessen, also die Möglichkeit, mich umzuziehen, das Federkleid zu wechseln, mal blau statt braun zu sein, obwohl dann wahrscheinlich die meisten aus meinem Clan gemeint hätten, das schaue „schwul“ aus. Ein Wort, das auch bei uns Spatzen ständig fiel. Tat man irgendwas außerhalb des Üblichen, sogleich war es schwul. Im Grunde hätte man sagen können, daß das, was ich derzeit unternahm, nämlich nach Wien zu fahren, auch ziemlich schwul war.
In der Bahnhofshalle pickte ich noch mehrere Brösel auf, schluckte einige Schokoladenstreusel und gleich darauf die Rinde eines Camemberts, an dem ein wenig Papier klebte, das köstlich war, das Papier. Ich meinte sogar, die Schrift zu schmecken, die hübsch verzierten Buchstaben. Ein Gedicht.
Zum Abschluß nippte ich kurz an der kleinen Lache, die ein umgestoßener Becher 7 Up auf dem Boden verursacht hatte. Natürlich mußte man da aufpassen, nicht von einem der vorbeimarschierenden Reisenden getreten zu werden. Aber die Bewegung der Menschen erzeugt einen Wind, den sie vor sich hertreiben, weshalb also jedem Bein eine Luftbewegung vorausging und ein Vogel meiner Größe immer erst von einem Luftstoß getroffen wurde, bevor ein Fuß ihn hätte erwischen können.
Gesättigt flog ich nach oben und verrichtete in einer entlegenen Ecke der Dachkonstruktion meine Notdurft, entließ einen Klecks Deckweiß. Was ich übrigens so viel hübscher fand als das Kotbraun der Hunde und Menschen. Nichtsdestotrotz zog ich mich in solchen Momenten gerne zurück. Das „Öffentlichkeitskacken“, wie ich es nannte und wie es ja viele meiner Artgenossen praktizierten, war nie meine Sache gewesen. Ohne Zweifel, ein starker Aspekt meiner Persönlichkeit war die Scham. Ich genierte mich schnell. Gehörte zu denen, die sich weniger vor einer Ungeschicklichkeit fürchteten als davor, dabei beobachtet zu werden. Und noch mehr als den Tod fürchtete ich, mitten auf der Straße zu sterben und in kläglicher Form Aufsehen zu erregen. Gleichzeitig war ich nicht jemand, der je den Mut verlor. Der Mut steckte mindestens so tief in mir wie meine Angst vor allem Peinlichen. Fast wie ein Geschwisterpaar.
Nachdem ich mein Geschäft erledigt hatte, flog ich wieder in die Halle hinunter, landete auf dem Dach eines Bistros und schaute zusammen mit den vielen Reisenden auf die große Anzeigetafel, wo immer zwanzig Minuten vor Abfahrt der Züge die Gleisnummern aufschienen. Weshalb die Leute wie in unsichtbaren Startboxen standen oder unruhig kleine Kreise um ihr Gepäck zogen.
Und dann war es soweit. Alle, die es betraf, stürmten los. Als hätten sie nicht zwanzig Minuten Zeit, sondern bloß zwanzig Sekunden. Ich paßte mich an. (Spatzen gehören unter den Tieren zu den sogenannten Kulturfolgern, was bedeutet, nicht nur den Menschen in die Städte und Dörfer zu folgen, sondern eben auch ihre Kultur nachzuahmen. Hektik beim Reisen erscheint als die Kulturleistung schlechthin. Das begriff ich. Gelassenheit war wohl eher was für Götter, Schwerbehinderte und Obdachlose; vielleicht rührte daher das Gerücht, erstere würden vorzugsweise in Gestalt der beiden letzteren auf Erden wandeln und Menschen testen.)
Es war ein TGV – ein Zug, der etwas Geducktes besaß, etwas von der Haltung eines Einbrechers –, in den ich über die Köpfe weg hineinflog und mir rasch zwischen den Koffern oben in den Gepäckfächern eine Ecke suchte, allerdings achtgeben mußte, in Folge einiger Umschichtungen nicht zerquetscht zu werden. Es gab ein Hin und Her, bevor dann endlich Ruhe war, sich alle Gegenstände an ihren Plätzen befanden und die Passagiere ebenso. Das Stimmengewirr schwoll ab. Schließlich vernahm ich das Signal der sich schließenden Türen. Ich spürte, wie das Gefährt sich in Bewegung setzte. Das war jetzt anders als in der Metro zuvor, endgültiger, dramatischer, dazu kam bald die beträchtliche Geschwindigkeit, von der ich bisher nur gehört hatte und die ich, auf einem Koffer sitzend, ähnlich erlebte wie ein Astronaut in seiner Kapsel. Mein Herz klopfte. Und sowenig ich von meiner Position aus etwas sehen konnte, spürte ich doch, wie sich Paris nach und nach entfernte, kleiner wurde, verschwand.
Mitten hinein in das Gefühl der Aufregung, auch in das Gefühl, sehr bald etwas Wesentliches, die Spatzenwelt Bewegendes zu erleben, mischte sich erneut eine Schwermut. Und zwar die des Heimwehs, was bisher auch nur ein Wort gewesen war. Zum Wort gesellte sich nun aber wirkliches Empfinden. Heimweh spürte sich an, als würde jemand hinter meinen Augen stehen – ähnlich der Stimme, die von einem Albatros stammt – und kräftig dagegendrücken. Als müsse ich gleich weinen. Auch wenn ich das als Vogel gar nicht konnte. Aber der Druck war dennoch da.
Heimweh also. Dabei war ich ja noch nicht einmal aus Frankreich heraus. Aber das Gefühl schien kaum von der Distanz abzuhängen. Es kam und ging. Und wie ich bald feststellen würde, kam es am liebsten, wenn es Abend wurde.
Und Abend war ja nun. Ich kauerte mich zu einem Knäuel zusammen, einer gefiederten Muschel, und schloß meine Augen, vernahm jedoch noch einige Zeit die Gespräche der Menschen und die Geräusche des Zugs, bevor der Schlaf und seine Träume mein Leben von außen nach innen kehrte.
Träumen Vögel vom Gehen auf zwei Beinen, so wie Menschen gerne vom Fliegen träumen?
Nun, bei mir war es sogar so, daß ich fast immer träumte, ein Mensch zu sein. Ich fühlte dann die Schwere meines Körpers wie auch die potentielle Langlebigkeit. Und betrachtete die Welt nicht mehr von oben, sondern zumeist aus einer Höhe von etwa ein Meter achtzig.
Es gab da einen Traum, der sich oft wiederholte. Besser gesagt, wiederholte sich die Persönlichkeit, die ich zu sein träumte. Wobei ich mich eben nicht nur im Körper dieses Mannes befand, sondern wirklich meinte, er zu sein, seine Gedanken zu denken. Solange ich träumte, führte ich seine Existenz, lebte seine Abenteuer, und damit auch die für einen Traum so typischen Verwicklungen, und war mir in keinem Moment bewußt, in Wirklichkeit ein Spatz zu sein. Natürlich nicht. In meinen Träumen kamen Spatzen nicht vor, zumindest nicht in einer persönlichen Weise, sie waren halt Vögel, die Parks und Biergärten frequentierten und ein wenig Lärm machten.
Ich hätte den Mann im Traum, der ich war, nicht beschreiben können. Nie schaute er in einen Spiegel. Aber es fühlte sich so an, als sei er nicht nur recht großgewachsen, sondern auch etwas, was die Menschen als „gutaussehend“ bezeichnen und damit eine gewisse Ebenmäßigkeit meinen. Eine Mustergültigkeit. Etwas Normales, Vertrautes, das aber dennoch besonders ist. Wie ein konventioneller Satz, der allerdings hervorgehoben wird, kursiv gesetzt. Ja, es handelte sich um einen kursivierten Mann.
Dieser Mann war einer von denen, die auch bei größter Hitze kaum schwitzten, ohne daß er darum, wie das Spatzen tun, zu hecheln anfing. Er schien eine andere Möglichkeit zu besitzen, seine Temperatur zu regulieren. Als sei er wechselwarm.
Er war beliebt, provozierte aber auch Neid. Allerdings nicht nur Neid, ebenso Mitleid. Wobei ich lange Zeit den Grund für dieses Mitleid nicht verstand. Das tat ich erst in dem Moment, als mir von einem Tennisspiel träumte, an dessen Ende mir der Gegner seine feuchte Hand reichte und erklärte: „Alle Achtung, mein Lieber, es ist umwerfend, wie Sie spielen, obwohl Sie den Ball gar nicht sehen.“
„Wie meinen Sie das?“
„Na ja …“ Der andere zögerte. Dann sagte er: „Fast könnte man glauben, Sie sehen ihn doch. Anders halt. Als würden Sie ihn spüren. Und beim Spüren sehen. Man könnte vermuten, daß sie ihn … äh … blind erkennen. Wenn Sie verzeihen, daß ich das so ausdrücke. Gegen Sie, mein Bester, verliere ich am liebsten. Nicht, weil Sie blind sind, sondern obwohl Sie blind sind. Sie sind ein Zauberer.“
Zum ersten Mal wurde ich mir der Brille in meinem Gesicht bewußt. Und ahnte, daß sie schwarze Gläser besaß und ich sie seit eh und je, Winter wie Sommer, trug. Aber ganz sicher nicht wegen der Sonne.
Von diesem Tennistraum erwacht, verstand ich endlich, daß der Mann, den ich so oft in meinen Träumen verkörperte, tatsächlich ohne Augenlicht war. Auf eine ziemlich vollkommene Weise. Vollkommen blind, so vollkommen, daß ich lange nicht kapiert hatte, mir die Dinge, so wie sie möglicherweise aussahen, nur vorzustellen. Und daß mein lockerer Gang allein der Routine zu verdanken war, mit der ich mich durch die Straßen in meinen Träumen bewegte. Ich erkannte die Stimmen vertrauter Personen, von denen ich schon lange ein Bild im Kopf hatte, so wie mir auch die Stimmen unvertrauter Personen augenblicklich ein Gesicht offenbarten. Oder eben die Vorstellung von einem Gesicht. Einem gedachten Gesicht. Ich bildete mir die Wirklichkeit ein. Offensichtlich gut genug, um sogar in einem Tennisspiel bestehen zu können.
Aber blind ist trotzdem blind. Und ich muß leider sagen, daß von dem Moment an, als mir klar wurde, mit welcher Behinderung ich lebte, sich diese auch viel stärker bemerkbar machte. Plötzlich stolperte ich, hatte manchmal Schwierigkeiten, einen Gegenstand zu finden, wußte nicht immer gleich, wer mich gerade angesprochen hatte, und vermied es nicht zuletzt, Tennis zu spielen. Ich sagte mir, daß ein Tennis spielender Blinder sich zum Narren macht, ein unwürdiges Schauspiel bietet, wie Löwen, die durch Feuerreifen springen, oder kleine Kinder, die als Quizkönige im Fernsehen auftreten. Aber in Wirklichkeit fürchtete ich, den Ball nicht mehr zu treffen.
Dennoch, auch ohne Tennis blieben mir viele Bewunderinnen erhalten. Ja, ich muß sagen, so spärlich in meinem realen Dasein als Spatz der Kontakt zum anderen Geschlecht ausfiel – ein halbes Kind noch –, so intensiv war er als erwachsener blinder Mensch in der Welt meiner Träume. Etwas, das immer dann, wenn ich erwachte, mir ein peinliches Gefühl bescherte. Und einen gewissen Schmerz im Unterleib, also ausgerechnet dort, wo ich den Sitz der Seele vermutete.
Es war komisch, als Vogel noch ein von der Sexualität unangetastetes Jugendleben zu führen, im Traum aber längst in diesen zwiespältigen Bereich vorgestoßen zu sein. Weshalb mir auch ganz recht war, mich nicht an alles erinnern zu können. Die Details verschwammen, und es blieb allein der morgendliche Druck auf meine unterleibige Spatzenseele.
Aber das sollte sich bald ändern.
Es war der Lautsprecher im Zug, der mich aus meinem Traum vom blinden Mann herausholte. Eine weibliche Stimme gab bekannt, wir würden demnächst Zürich erreichen, und auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig stehe der Nachtzug nach Budapest über Wien-Westbahnhof bereit. (Die Mitteilung erfolgte in Französisch wie auch auf Deutsch, wobei ich doch mit einigem Erstaunen feststellte, nicht nur die vertraute Sprache, sondern ebenso die unvertraute bestens zu verstehen. Aber wie ich schon erwähnt habe, ich hatte die französische Sprache ja nicht erlernt. Das Verstehen schien automatisch, angeboren und intuitiv. Was offensichtlich bei jeder Sprache funktionierte, während mir etwa das Gekläff eines Hundes rein gar nichts sagte. Andererseits bemerkte ich durchaus die Unterschiede, ich würde sagen: die verschiedenen Geschmäcker. Französisch schmeckte zugleich salziger und süßer als das Deutsche, das ich – mir ein Brot vorstellend – als deren Rinde ansah, keine harte oder trockene, aber eben Rinde, leicht knusprig, dazu der Eindruck von etwas Verbranntem. Zusätzlich war es so, daß mir die eigentliche Bedeutung mancher Begriffe unklar blieb. Doch auch im Gespräch der Spatzen untereinander war nicht immer eindeutig, was mit einem bestimmten Wort genau gemeint war. So blieb es absolut verwirrend, was verschiedene Spatzen etwa unter „Frieden“ verstanden.
Ich beeilte mich, den Platz zu wechseln, bevor wieder die Kofferschieberei losging, und flog hinüber in den Vorraum, dort, wo die Außentüren waren. Ich quetschte mich in eine Nische und wartete. Klein und kompakt. Beinahe wäre ich wieder eingeschlafen. Schließlich gehörte ich nicht zu den nachtaktiven Vögeln. Allerdings würde ich in der nächsten Zeit eine diesbezügliche Flexibilität entwickeln müssen. Das ahnte ich bereits, mich nicht auf den normalen Rhythmus eines Spatzen berufen zu können. Sondern noch stärker das Prinzip zu leben, einer Kultur zu folgen. Der Kultur des Abenteuers, zu dessen markanten Attributen eine Durchbrechung typischer Schlafgewohnheiten gehörte.
Die Türen öffneten sich, und die Menschen drängten hinaus. Über ihren Köpfen flog ich auf den Bahnsteig und glitt direkt in den wartenden Nachtzug, der hier „Euronight“ hieß, obgleich wir durch kein einziges englischsprachiges Land fahren würden. Ich hätte darum vorgezogen, in einem Zug zu sitzen, der den schönen Namen „Europäische Nacht“ trägt, so wie umgekehrt das englische „pea“ sich so viel hübscher anhört als das deutsche „Erbse“.
Dieser Nachtzug war in seinem Inneren ganz anders als der möblierte TGV, aus dem ich gerade gekommen war. Hier waren es kleine Schlafkabinen, in die sich nun die Umsteigenden hineinzwängten. Die meisten Türen waren bereits verschlossen, aber ich spürte die Anwesenheit derer, die dahinter auf ihren schmalen Betten lagen und stöhnten. Vor Hitze stöhnten. Auch auf dem Gang war es fürchterlich warm und die Luft mehr zu schlucken als zu atmen. Wirklich hörte ich, wie einer der Zugbegleiter von einer defekten Klimaanlage sprach. Der Gast, dem er dies erklärte, beschwerte sich lautstark ob der unerträglichen Hitze und verlangte, in einem anderen Waggon untergebracht zu werden. Er tat dies in einem Deutsch, von dem mir erst später klar wurde, daß es sich um jene spezielle Version des Deutschen handelte, wie man sie in Wien pflegte und wie man vielleicht sagen kann, Rückenschwimmen sei eine spezielle Form der Fortbewegung im Wasser. Eine Schwimmtechnik, bei der man nicht sehen kann, wo man hinschwimmt. Ja, ich sollte noch begreifen, wie sehr das Wienerische an jemand erinnert, der sich mit seinem Rücken voran bewegt, aber seinen Mund am Hinterkopf trägt. Nur den Mund. Er redet also praktisch nach vorne, schaut aber nach hinten. Schaut in die jüngste Vergangenheit, dorthin, wo er vor kurzem gewesen war.
Ich scheute mich, in eines der noch offenen Abteile zu fliegen. Da drinnen würde ich eingesperrt sein, zudem war mir klar, daß sich in diesen engen Räumen die warme Luft noch schlimmer staute. Wie peinlich es doch gewesen wäre, bereits zu Beginn dieser Reise, dieser Mission, einen Hitzschlag zu erleiden, zu sterben allein auf Grund einer körperlichen Schwäche. Des Makels, nicht schwitzen zu können.
Wasser! Richtig, ich mußte trinken. Ich spürte bereits einen leichten Schwindel. Während ich nun etwas verkrampft durch den Gang trudelte, bot sich die Möglichkeit, den Waggon zu wechseln, da soeben zwei Zugbegleiter herüberkamen. Zusammen mit einem dritten Mann bildeten sie ein Team der Hilflosigkeit. Ein freundliches Team, wie ich bald beurteilen konnte. Ein Inder, ein Türke und jemand, der Slowake war. Inder und Türken kannte ich aus Paris, Österreicher und Slowaken lernte ich erst auf dieser Reise kennen. Jedenfalls versuchten die drei vergeblich, die gottverdammte Klimaanlage unter Kontrolle zu bringen, drehten verzweifelt an den Knöpfen und Reglern und fingen schließlich damit an, Gäste in den nächsten Waggon umzuquartieren. In ein völlig entgegengesetztes Klima. Denn auch die Kühlung, die dort bestand, blieb völlig unkontrolliert. Es herrschte Eiszeit. Die kalte Luft strömte aus den Gebläsen und verband sich zu arktischen Wirbeln. Fehlte eigentlich nur noch, daß es zu schneien anfing. Dennoch fand ich es hier um einiges erträglicher als in der stehenden Hitze zuvor. Zudem entdeckte ich einen guten Platz im vorderen Abteil, wo die Lebensmittel untergebracht waren und die Türe stets offenstand, da die Zugbegleiter ein und aus gingen. Um sich zu beraten, kurz auszuruhen oder Getränke und kleine Speisen bereitzustellen.
Einmal kam ein Junge im Schlafanzug vorbei. Er trug eine Baseballkappe, einen Schal und verlangte eine Flasche Fanta. Der Inder blickte ewig lange in die geöffnete Kühlbox. Es sah aus, als wolle er die vielen verschiedenen Flaschen hypnotisieren. Oder aber die hypnotische Kraft ging von den Getränken aus. Irgendwann beugte sich auch der Junge über den Rand und schaute ebenso gebannt auf die Flaschen. Endlich zog der Inder eine davon heraus und reichte sie dem Kind.
„Das ist keine Fanta, sondern ein Apfelsaft gespritzt“, erklärte der Junge. Und meinte: „Sie sind ein Rekrut, gell?“
„Ein Rekrut?“
„Na, wie in diesem Star-Trek-Film, Der Zorn des Khan, wo fast nur Rekruten auf dem Schiff sind, und die sollen ja eigentlich bloß trainieren, dann aber kommt ein Notruf, und es wird ernst.“
Der Inder gestand: „Das ist mein erster Tag hier.“
„Also, ich nehm auch den Apfelsaft“, sagte der Junge, was ich erstaunlich fand, weil er ja mit einem einzigen Griff eine Fanta hätte herausziehen können.
Es hatte dann sehr viel Würde, wie der indische Zugbegleiter deutscher Sprache die Flasche öffnete und einen Strohhalm durch die schmale Öffnung führte. Es wirkte magisch, rituell, indisch natürlich, so, als füge er ein künftiges Glück in diese Flasche, aus welcher nun der Junge einen ersten Schluck nahm.
Ja, bei diesen drei Zugbegleitern schien es sich tatsächlich um Rekruten zu handeln, Rekruten ohne einen Captain weit und breit, ohne Ingenieur, der die Klimaanlage hätte reparieren können. Auch wäre mir nicht aufgefallen, daß einer von ihnen über den anderen beiden gestanden hätte. Keiner, der das Sagen hatte. Weshalb sie viel diskutierten. Die Klimaanlage gaben sie freilich irgendwann auf. Sie beugten sich dem Geist der Maschine und verbrachten die halbe Nacht damit, Passagiere aus der Sauna in den Eisschrank umzusiedeln. Den anderen Teil der Nacht waren sie mit der Vorbereitung des Frühstücks beschäftigt, welches kurz vor der Ankunft in Wien ausgeteilt werden sollte. Sie besprachen immer wieder ihren Plan, einen Wer-was-wohin-Plan. Keinesfalls wollten sie zulassen, daß einer der Gäste ohne Mahlzeit den Zug verlassen mußte. Zudem waren ja verschiedene Arten von Frühstück bestellt worden, das mußte alles bedacht werden. Wiederholt studierten sie Papiere und Listen und waren bemüht, in dem kleinen Raum sämtliche Zutaten aufzutreiben. Keiner von ihnen schien jemals zuvor in diesem Zug gewesen zu sein. Man kann sagen: Sie befanden sich auf einem fremden Schiff. Sie waren nicht dumm, und schon gar nicht waren sie faul, aber sie waren Dilettanten, die man ohne jede Ausbildung in dieses Fahrzeug gesteckt hatte (auch wenn keine Bahngesellschaft so etwas zugeben würde, doch es stimmt, daß auf gewissen Strecken ungelernte Höllenfahrtkommandos zum Einsatz kommen, Leute, die dem Fluch der Lohnarbeit erlegen sind und die, anstatt in Indien oder in der Türkei oder Slowakei glücklich oder unglücklich zu werden, jetzt zwischen Zürich und Wien den Zorn des Khan ertragen müssen).
Ich hatte mich ganz oben in einen schmalen Spalt zwischen einem Kästchen und dem Plafond gedrückt. Dort saß ich gleichsam wie in einer dunklen Loge und konnte die Komödie der Rekruten verfolgen. Allerdings war es auch an dieser Stelle eiskalt, und ich hatte alle Mühe, meinem sommerlichen Federkleid eine winterliche Dichte zu verleihen. Sobald die drei Männer die Kabine verlassen hatten, flog ich hinunter, setzte mich in das Abwaschbecken und drückte meinen Schnabel in einen großporigen Schwamm, um das Wasser herauszusaugen. Es schmeckte wie aus der Toilette, allerdings begriff ich es als Teil meines Abenteuers, solches Wasser zu trinken. Mich zu überwinden. Zur Not vielleicht doch noch Würmer zu essen.
Apropos. Oberhalb des Beckens entdeckte ich eine offene Packung, deren Inhalt mich zuerst erschreckte, weil ich dachte, es handle sich der Form wegen tatsächlich um Würmer, ockerfarbene Köder, die ein Angler hier vergessen hatte (wie jener Bahnhofsangestellte auf dem Gare Montparnasse, der die grauslichen Dinger immer ins Büro mitnahm). Doch dann registrierte ich die absolute Bewegungslosigkeit dieser Gebilde, erkannte den Geruch von etwas Gebackenem. Und begriff endlich, daß es sich um sogenannte Erdnußflips handelte, von denen ich zwar schon gehört, sie aber noch nie gesehen oder probiert hatte. Was sich nun änderte. Ich fiel über das gepuffte Maismehl her. Der Geschmack von Erdnuß und Sonnenblumenöl, nicht zuletzt das Aroma gesalzener Luft erzeugten in meinem Körper eine erlösende Wärme. Ich stopfte mich richtig voll, wie um eine Dampfmaschine in Bewegung zu setzen. Erst die Stimmen zweier heranrückender Rekruten bereiteten meinem Schmaus ein Ende. Ich flog hoch zur Loge. Und fühlte mich nun weitaus gewappneter, die Nacht an diesem im wahrsten Sinne zugigen Ort zu verbringen.
Ich nickte ein. – Richtig, Vögel schlafen anders als Menschen, kürzer, dafür öfter, die Nacht mittels vieler einzelner Schlafphasen punktierend, man könnte sagen: eine Schlafnaht stickend, ein regelmäßiges Muster mit kleinen Wachpausen. Man muß halt auf der Hut sein und hat bei Gefahr nicht die Zeit, sich ewig lange zu strecken und zu gähnen und aus dem Bett hochzukommen. Allerdings war ich auch in dieser Hinsicht bislang ein echter „Kulturfolger“ gewesen, nämlich ein guter Schläfer. Dank meines Nachtquartiers in der Dachkonstruktion des Gare Montparnasse, wo man sich mit anderen zusammendrängen konnte und wie in einer wollenen Wolke steckte. Und dabei sehr viel länger durchschlief und sehr viel mehr träumte – und vor allem ganz anders –, als in der Wissenschaft über Spatzen allgemein behauptet wird.
Aber das wandelte sich an diesem Ort. Immer wieder schreckte ich aus dem Schlaf und meinen Träumen hoch, für einen Moment fürchtend, entdeckt worden zu sein. Doch es war allein das Hin- und Herschieben von Laden und Kisten, die Klospülung um die Ecke, das Gerede der Rekruten, das mich weckte, oder das Gedonner, das erfolgte, wenn unser Zug an einem anderen vorbeifuhr und man meinen konnte, zwei Autorennfahrer, in entgegengesetzter Richtung unterwegs, würden einander beinahe küssen. – Meiner Vorstellung drängten sich schon seit einiger Zeit Bilder auf, die ziemlich eindeutig nicht aus meinem Spatzengehirn stammen konnten, sondern aus dem Gehirn des blinden Mannes, der ich gleichfalls war.
Natürlich träumte mir auch diese Nacht von ihm. Wobei es mir im nachhinein so vorkam – nachdem mich das wärmende Rotorange der Sonne auf dem Weiß der Milchglasscheibe endgültig geweckt hatte –, als würde er langsam zu zweifeln beginnen. Ohne jetzt sagen zu wollen, er hätte geahnt, in Wirklichkeit ein Spatz zu sein. Aber doch, daß etwas nicht stimmte. Ähnlich den Leuten, die auf einem Gemälde, das sie seit Jahren kennen, eine Veränderung bemerken. Eine Veränderung, die erstaunlicherweise auch auf allen Reproduktionen dieses Gemäldes zu sehen ist. Und man sich fragt, ob man wahnsinnig geworden ist. Oder vielmehr, ob man vielleicht vorher wahnsinnig war und, endlich geheilt, des wahren Bildes ansichtig wird.
Die Rekruten befanden sich in größter Eile, um alle Frühstücke an die richtigen Plätze zu befördern. Es roch herrlich nach Kaffee, ein Geruch, der mir natürlich aus meinem Bahnhofsleben bestens vertraut war. Allerdings hatte ich noch nie davon gekostet. Die älteren Spatzen rieten davon ab. Sie meinten, daß man die Bewußtseinssteigerung, die mit dem Genuß einherging, teuer bezahlen würde. Womit eigentlich, das sagten sie nicht. Aber die Angst vor dem Kaffee kursierte und hatte auch mich bislang abgehalten. Doch ich roch ihn so gerne. Als rieche man ein Miniuniversum. Gute dunkle Materie.
Nachdem alle Gäste versorgt waren und morgendliches Gemurmel und Gelächter aus den offenen Kabinen drang, standen die drei Zugbegleiter beisammen und nippten ihrerseits an den mit Kaffee gefüllten Plastiktassen. Da trat ein Fahrgast zu ihnen und verlangte nach Zucker. Er beschwerte sich nicht, sondern bat einfach darum. Der Inder beeilte sich, ihm zwei Päckchen zu reichen. Ich konnte gut hören, wie die kleinen Kristalle sich aneinander rieben.
In diesem Moment bemerkte ich den Blick. Den Blick des Mannes, der wegen des Zuckers gekommen war. Er war schon etwas älter, sein fürsorglich gestutzter Bart weiß, das Haar grau, so, als sei der Bart bereits ein Stück weiter in der Zukunft. Der Mann trug eine dunkle Krawatte zum weißen Hemd und einen sehr ordentlich sitzenden dunkelgrünen Wollanzug mit dünnen blauen Streifen kreuz und quer. Er besaß den Körper von jemand, der gerne gut aß und dessen Flecken im Gesicht vom hohen Blutdruck oder vom Genuß der Schnäpse oder von beidem herstammen mochte. Aber er war nicht dick, sondern kompakt. Jemand, an dem man schwer vorbeikam, dem allerdings auch eine plötzliche Beweglichkeit zuzutrauen war. Die Schnelligkeit eines Bären. Und dieser mögliche Bär sah zu mir hoch, ohne dabei den Kopf zu heben. Nur seine Pupillen fuhren ein kurzes Stück aufwärts. Das dauerte keine Sekunde, aber in dieser Beinahesekunde hatte er mich entdeckt und mit seinen Augen fixiert. Dieser Blick ging, wie man so sagt, durch mich hindurch. Aber eben nicht vollständig wie eine Kugel, sondern nur bis zur Mitte des Körpers. Nachher, als der Blick sich wieder zurückgezogen hatte, war etwas geblieben. Etwas in der Art eines Senders, einer Bombe oder einer Krankheit. Ich fühlte mich augenblicklich unwohl. Dabei war ja nicht wirklich etwas geschehen. Der Mann mit weißem Bart und grauem Haar dankte für den Zucker und trat wieder in den Gang hinaus.
War es purer Zufall gewesen, daß er nach oben geblinzelt hatte? Warum aber hatte er nichts gesagt? Hätte es sich denn nicht angeboten, die Zugbegleiter zu fragen, ob sie wüßten, einen Vogel in ihrem Abteil zu haben? Oder hatte er gedacht, dieses still stehende Tier sei aus Kunststoff? Oder gar ausgestopft? Dann allerdings hätte sein Blick doch etwas überraschter ausfallen müssen. Präparierte Vögel in Zügen?! Man stelle sich vor!
Na gut, vielleicht hatte er mich auch gar nicht gesehen. Vielleicht hatte ich seinen Blick mißverstanden, und selbiger war überhaupt nicht in mich eingedrungen, sondern knapp vorbeigesegelt, und allein die Nähe hatte mir ein Gefühl des Getroffenseins beschert. Wie bei Boxern, die von einem Schlag zu Boden gehen, der sie verfehlt hat und wo nachher alle „Betrug“ und „Schiebung“ rufen.
Wien Westbahnhof!
Ich wartete ab, bis auch die Rekruten das Abteil verließen, dann flog ich in den Gang hinaus und flatterte oberhalb des Menschen- und Koffergedränges hinaus ins Freie. Froh um einen Bahnhof. So war die Fremde nicht ganz so fremd. Darum auch strebte ich vorerst nicht ins Freie, sondern wechselte vom Bahnsteig in die Halle und steuerte auf ein Gebilde in der Mitte zu, eine kreisrunde Informationssäule, deren obere Abdeckung mir einen idealen Ausblick zu bieten versprach. Die ganze Bahnhofsanlage wirkte auf mich sehr viel sauberer, als ich das gewohnt war. Dieser Wiener Westbahnhof hatte etwas Glattes und Glänzendes, Goldenes und Aufgeräumtes. Was nun ganz im Widerspruch zu dem Klischee stand, Wien sei eine eher dreckige Stadt, zwar nicht dreckiger als Paris, aber dreckiger als zum Beispiel Hamburg oder Kopenhagen. In jedem Fall konnte ich hier nirgends Spatzen entdecken. Gab es überhaupt Spatzen in Wien? Außer dem einen, der Pinesits hieß und der vielleicht genau darum in diese Stadt gezogen war, um von seiner Art verschont zu bleiben?
Nun, das war ein Irrtum, wie sich bald herausstellen würde. Vorerst aber bemerkte ich etwas ganz anderes. Etwas …
Chiummmzupf!
Ein Schlag holte mich von der Kante, auf der ich eben noch gesessen hatte. Ich stürzte. Aber diesmal war es kein vom Himmel gefallener Artgenosse, der mich mitgerissen hatte. Sondern etwas sehr viel Kleineres und sehr viel Schnelleres. Ich schlug hart auf den steinernen Boden auf. Eine kurze Bewußtlosigkeit ereilte mich, ein Sekundenschlaf. Als ich die Augen wieder öffnete, erkannte ich sofort die zerfetzte Stelle an meiner linken Flanke. Zuerst sah ich sie, dann spürte ich sie. Gott sei Dank unterhalb des Flügels. Es würde mich weder umbringen noch am Fliegen hindern. Weh tat es trotzdem.
Auch wenn ich etwas Derartiges noch nie in natura gesehen hatte, wußte ich sofort, daß es sich um einen Streifschuß handelte. Es gab eine richtiggehende Spur, einen Graben im Gefieder, der bis zur Haut führte und dort eine Wunde verursacht hatte. Nicht tief, aber auch kein Spaß. Klar, ich hätte tot sein können und wohl auch sein sollen. Der Schuß war wohl kaum als bloße Warnung gedacht gewesen.
Nicht als die Warnung, zu der er nun geworden war.
Ich rappelte mich hoch, flatterte zur Seite und ging neben einem massiven Pfeiler in Deckung. Eine allgemeine Panik der Passanten wäre mir jetzt sehr recht gewesen. Doch niemand schien den Schuß bemerkt zu haben. Vielleicht war er im Lärm einfach untergegangen. Oder zusätzlich gedämpft gewesen. Wattiert.
Wäre ich eine Taube gewesen, ich hätte einen Taubenhasser vermuten können. Oder … Es gab da etwas, was die Menschen „verirrte Kugeln“ nannten. – Dann aber sah ich ihn, den Mann im Wollanzug. Er näherte sich, in der einen Hand den Griff des Koffers, den er hinter sich herrollte, in der anderen einen dünnen dunkelblauen Mantel, der wie ein erlegter Schatten über seinem angewinkelten Unterarm hing.
Ich erkannte seine Verblüffung, als er die Stelle, wo ich hätte liegen müssen, leer vorfand. Er hob den Kopf, drehte ihn … jetzt erblickte er mich. Da hockte ich, ein paar Schritte von ihm entfernt, gegen den kalten Stein des Pfeilers gepreßt, starr, nun tatsächlich wie ausgestopft.
Sich totstellen war in diesem Fall jedoch eine schlechte Lösung. Nicht bei Leuten, die Vogelleichen einzusammeln und in Plastiktüten zu stecken pflegten. Der Kerl war mit Sicherheit ein Agent der Totalisten. Ein Agent und Scharfschütze. Weit weniger stereotyp als die beiden Ohrstöpselträger tags zuvor in Paris. Was jedoch alles andere als ein Trost war.
Ich bemerkte, wie er seinen Arm und damit auch seinen Mantel ein Stück in meine Richtung schob. Nicht, daß ich den Lauf der Waffe hätte erkennen können beziehungsweise die Mündung eines Schalldämpfers, aber mir war klar, was jetzt geschehen sollte. Er würde diesmal versuchen, meinen Kopf zu treffen. Eine Kugel in mein Spatzenhirn zu jagen. (Daß dieser Begriff, der des Spatzenhirns, unter Menschen als Ausdruck für Dummheit steht, finde ich in Ordnung, schließlich spricht unsereins auch gerne vom Menschenhirn und meint damit nicht das von Genies.)
Mag sein, daß es als romantische Verklärtheit gilt zu sagen, es seien immer die Kinder, die Tiere retten. Und daß einige Kinder – willentlich oder auch ferngelenkt – in höherem Auftrag handeln. Faktum war, daß in diesem Moment ein Junge zwischen mich und den weißbärtigen Mann trat. Hätte er sich hinuntergebeugt oder wäre in die Hocke gegangen, der Agent hätte gut und gern das Projektil auf die bereits feststehende Flugbahn schicken können. Doch der Junge stand einfach da, erstaunlich breit für seine etwa dreißig Kilo, und schaute interessiert auf mich hinunter. Mir kam vor … War er nicht derselbe, der sich mit dem Apfelsaft statt der bestellten Flasche Fanta zufriedengegeben hatte? Nur, daß er jetzt keinen Pyjama trug, sondern kurze Hosen und ein übergroßes Leibchen, so ein Fußballtrikot, mit einer Spielernummer darauf, 33, wenn ich mich in der Aufregung nicht irrte.
Einen Moment dachte ich an die Möglichkeit, der Killer – man stelle ihn sich ohne jeden Skrupel vor – könnte versuchen, durch das Kind hindurchzuschießen, um mich trotz des lebendigen Schilds zu treffen. Schließlich konnte man bei den Menschen nicht ausschließen, daß sie die Tötung eines Kindes billigend in Kauf nehmen. Nicht nur im Krieg nicht. Selbst durchschnittliche Autofahrer schienen zu akzeptieren, im Zuge einer gewissen sportlichen Fahrweise die Kleinsten und Schwächsten zu gefährden. Nicht, daß sie unmittelbar auf eine Tötung aus waren, doch nur wegen einer bloßen Möglichkeit das Tempo zu drosseln …
Ich hätte eigentlich, um jegliche Schädigung des Jungen ausschließen zu können, zur Seite hüpfen und erneut ein ungedecktes Ziel abgeben müssen.
Ich hätte …
Wenn der Agent der Totalisten es jetzt unterließ zu schießen, dann vielleicht ja doch, um das Kind zu schonen, vielleicht auch nur, weil er fürchtete, die Kugel könnte im Zuge einer „Kindesdurchquerung“ abgelenkt werden und mich ein weiteres Mal verfehlen. Beziehungsweise zu einem weiteren Streifschuß führen. Was dann dem Ruf dieses Mannes und Scharfschützen sehr geschadet hätte, zweimal einen Spatzen nur fast getötet zu haben.
So viele Gedanken in so kurzer Zeit.
Wie auch immer, kein Schuß fiel. Ich nutzte das Gottesgeschenk dieses zwischen mich und den Killer getretenen Kindes, löste mich endlich aus meiner Starre, drehte mich um, hüpfte zwischen die Stangen des Geländers und ließ mich in den unteren Teil der Halle fallen. Schaffte es, knapp über dem Boden gerade noch nach oben zu ziehen, und steuerte mit aller Kraft, mir den Schmerz verbeißend, dorthin, wo Rolltreppen in den unterirdischen Bereich führten. Es hätte jetzt eines Marschflugkörpers bedurft, mit der Fähigkeit, die Kontur eines Sperlings zu erkennen, mich noch zu treffen.
„Heinrich Steinfest ist in seiner Surrealität einer der realistischen Autoren der Gegenwart. In seinen ganz und gar unberechenbaren Romanen hält er der Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts seinen geistreichen Spiegel vor.“
„Lohnt sich!“
„Das ist recht abenteuerlich, geht sehr verwickelt und phantasievoll weiter und unterhält wirklich originell.“
„Vergnügliche Lektüre, wie immer bei diesem Autor garniert mit allerhand philosophischen Abschweifungen, zitierfähigen Sprüchen sowie jeder Menge verrückter Ideen am Rande.“
„Ein spannender unterhaltsamer Tier-Mensch-Krimi zum Lesen und Verschenken.“
„Der aberwitzige Agentenroman ist ein Drahtseilakt zwischen Phantasie und Wirklichkeit“
„Hervorragend schildert Steinfest mit viel Witz und Sarkasmus die verrücktesten Szenarien, fädelt gekonnt die skurrilen Übergänge zwischen Traum und Realität ein und baut dadurch sehr geschickt eine komplexe Geschichte auf.“
„Heinrich Steinfest hat mit ›Das Leben und Sterben der Flugzeuge‹ einen Roman verfasst, der verdientes Lob erntete (...). Es überzeugt, wie er vom Verschwinden eines malaysischen Flugzeugs erzählt, infolge eines vertrackten Spiels mit Fantastik und Realität in ihren unscharfen Grenzen.“
„Ein Ausflug in eine bizarre (Parallel-) Welt, originell und überraschend.“
„Ein wenig Krimi, ein wenig Fantasy, viel Witz und ein mit Illustrationen des Autors schön gestaltetes Buch: Steinfests Roman ist ein Fest für Sprach- (und Vogel-) Liebhaber.“
„Heinrich Steinfest schreibt keine Texte, die man einfach so wegliest. Seine Bücher sind vielmehr ausgefeilte literarische Kunstwerke, geprägt von einem feinen, hintersinnigen, sagen wir: wienerischen Humor.(...) Wer sich darauf einlässt, der wird einen Höllenspaß an dieser vertrackten, verschachtelten Geschichte haben.“
„Die Spatzen pfeifen es von den Dächern - dieser Heinrich Steinfest schreibt so revolutionär und so ideenreich, wie seit Friedrich Schiller in Stuttgart niemand mehr geschrieben hat.“ Denis Scheck
„Dieses Buch hat mich zum Lachen und zum Staunen gebracht (...) es ist nicht unpolitisch, manchmal philosophisch und tiefgründig, aber auch locker und witzig geschrieben...“
„Der Roman ist weniger abgehoben, als man glauben könnte. Er flüchtet nicht. Er geht bloß einen besonderen Weg, um an tiefere Wahrheiten zu gelangen.“
„Es macht Spaß, den beiden Protagonisten bei ihren Abenteuern zuzusehen und ihren teils abwegig erscheinenden Gedanken zu folgen.“
„Steinfest schafft eine packende Mischung aus Agenten-, Kriminal- und Gesellschaftsroman, in dessen Fiktion zudem tatsächlich Rätselhaftes wie das Verschwinden des Malaysia-Flugzeugs eine originelle Erklärung findet.“
„Unnachahmliches Lesevergnügen“
„Seine Gratwanderung zwischen Phantastischem und Realität gerät ihm auch diesmal wieder zu einem hochliterarischen Drahtseilakt, der die Lektüre dieses Romans zu einem überaus spannenden, ja atemberubenden Vergnügen macht.“




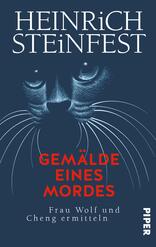











Hab das Buch beim Spazieren gehen gelesen, war ein echt spannender skurriler Rundflug
Von einem Kommissar, der ein Spatz ist und einem Spatzen, der zu viel wusste . Was Heinrich Steinfest uns hier vorlegt, ist mehr als ein grandioses Verwirrspiel um verschwundene Wissenschaftler, Spatzenkrieger, Spionage, geheimnisvolle Rüstungen und Verwischungen von Zeit und Raum. Es ist ein Fest der Fabulierkunst. Ein brillant erzähltes Stück Literatur mit einem Blick auf die Wirklichkeit, die uns in Erstaunen versetzt. Der neue Roman von Heinrich Steinfest gehört zu dem besten, was dieser Leseherbst zu bieten hat.
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.