
Das kalte Haus
Meine unglückliche Kindheit in einer heilen Familie
„Dass er sich unter dem Pseudonym Martin Osterberg noch einmal auf den Weg zurück gemacht hat und die Situation seiner Kindheit und Jugend in der Wohlstandsversorgung beleuchtet, ist eine große Stärke seines Buchs.“ - neue-buchtipps.de
Das kalte Haus — Inhalt
Martin Osterberg hat Eltern und einen Bruder, aber er will mit ihnen am liebsten nichts zu tun haben. Denn bis er selbst eine Familie gründet, verbindet er damit nichts Liebevolles, sondern vor allem Sprachlosigkeit und Ablehnung. Heute Anfang Fünfzig beschreibt er beklemmend und ohne Larmoyanz, was viele Männer seiner Generation erlebten: Die emotionale Verwahrlosung und Kälte einer Zweckgemeinschaft, in der materieller Wohlstand und Leistung wichtig sind, die Väter meist abwesend oder desinteressiert und die Mütter hilflos. Was in der Kindheit beginnt und in der Pubertät eskaliert, setzt sich im Erwachsenenalter fort: Sein Vater bezeichnet ihn bei einem seiner seltenen Besuche als „Arschloch“, seine Mutter schweigt. Er braucht fast ein ganzes Leben, um sich von seinen Eltern und deren Bild von ihm zu lösen.
Leseprobe zu „Das kalte Haus“
Ich bin ein Arschloch. Ich weiß das aus allererster Hand. Mein Vater hat es mir gesagt. Der soll ruhig wissen, hat er zu seiner Frau, meiner Mutter gesagt, dass er ein Arschloch ist. Er hat auf meiner Couch gesessen, in meinem Wohnzimmer, neben meiner Frau. Er hat mich angeschaut, als hätte er bloß festgestellt, dass das Wetter auch schon mal besser war. Er hat nicht gelächelt, er hat sich nicht entschuldigt, er hat nichts weiter gesagt. Ich habe auch nichts gesagt. Ich habe gedacht: Ja, du auch.
Dann hab ich noch einen Schluck Weißwein genommen. Von [...]
Ich bin ein Arschloch. Ich weiß das aus allererster Hand. Mein Vater hat es mir gesagt. Der soll ruhig wissen, hat er zu seiner Frau, meiner Mutter gesagt, dass er ein Arschloch ist. Er hat auf meiner Couch gesessen, in meinem Wohnzimmer, neben meiner Frau. Er hat mich angeschaut, als hätte er bloß festgestellt, dass das Wetter auch schon mal besser war. Er hat nicht gelächelt, er hat sich nicht entschuldigt, er hat nichts weiter gesagt. Ich habe auch nichts gesagt. Ich habe gedacht: Ja, du auch.
Dann hab ich noch einen Schluck Weißwein genommen. Von demselben Weißwein, von dem mein Vater ein paar Schlucke zu viel genommen hat. Der Weißwein stammt von ihm, einmal im Jahr, kurz vor Weihnachten, kommt eine Direktlieferung vom Lieblingswinzer meines Vaters. Jetzt aber ist es Spätsommer, meine Eltern sind zu Besuch. Sie sind 400 Kilometer mit dem Auto gefahren, sie haben Leckereien mitgebracht, sie haben Gastgeschenke verteilt, dann haben sie sich zum Abendessen hingesetzt, und mein Vater hat das erste Glas Wein getrunken. Nach dem Essen sind alle auf die Couch umgezogen, um weiter Wein zu trinken. Irgendwann war die erste Flasche leer, und ich habe eine zweite aus dem Keller geholt. Als die zweite Flasche leer war, hat mein Vater gesagt, ich soll noch eine dritte holen.
Also bin ich in den Keller gegangen, und dort im Keller war ein Moment Zeit, um nachzudenken. Es war kühl, und es war ruhig, und ich wusste, dass nun bald der kritische Pegel erreicht sein würde, bei dem mein Vater nicht mehr kühl und ruhig sein würde. Dass bald der Augenblick kommen musste, in dem ihn das Gefühl übermannen würde, nicht laut, aber sehr selbstgewiss ein paar Wahrheiten verkünden zu müssen.
Ich wusste noch nicht genau, welche Wahrheiten. Ob eine über Menschen mit einer anderen Hautfarbe als er, ob eine über die Juden, ob über gierige Banker oder grüne Politiker oder irgendwelche andere Idioten aus einer Welt, in der alle Idioten waren außer meinem Vater. Vielleicht würde er auch eine Wahrheit verkünden über jemanden, den ich gut kannte, vielleicht eine über mich. Ich wusste nicht, was kommen würde. Aber ich wusste nur zu gut, dass etwas kommen würde. Ich wusste auch, ich würde es nicht verhindern können.
Trotzdem wusste ich, was zu tun war. Ich besitze Erfahrung aus unzähligen Scharmützeln und Schlachten. Ich bin ein Veteran des Krieges zwischen mir und meinem Vater.
Im Keller pustete ich den Staub von der Weinflasche und nahm mir vor, das zu tun, was ich immer tat, wenn der Waffenstillstand gebrochen zu werden drohte: ignorieren und den Abend möglichst schnell beenden.
Denn so schnell wird aus dem kalten Krieg gewöhnlich kein heißer mehr. Nicht mehr. Nach all den Jahren, all den offenen Feldschlachten, den demütigenden Niederlagen und den demoralisierenden Pyrrhussiegen sind die Kombattanten müde. Ab und an startet Nordkorea mal wieder eine Testrakete, der Süden reagiert mit einem halbherzigen Manöver oder schickt die Diplomaten in die Spur. Eines ist klar: Diese Teilung wird niemals überwunden werden, aber trotzdem bleiben die beiden Länder auf ewig miteinander verbunden, auf ewig dazu verdammt, immer mal wieder einen Abend zusammengepfercht auf einer Couch zu verbringen.
Zurück auf der Couch aber versagte die bewährte Strategie. An diesem Abend brach an der schwerbewachten Grenze wieder einmal eines der selten gewordenen Gefechte aus. Die dritte Flasche war geleert, die Hemmungen gefallen, die Munition lag bereit. Diesmal waren die Enkeltöchter dran. Mein Vater meinte, meine große Tochter, seine Enkelin, solle sich doch gefälligst regelmäßiger bei ihm telefonisch melden. Die Enkelin war nicht da, sie besitzt längst ein eigenes Leben in einer anderen Stadt, also verteidigte ich meine Tochter. Wie alle in diesem Alter sei sie halt nicht allzu verlässlich, sagte ich, auch bei uns, ihren Eltern, würde sie sich nur selten melden. Was alte Säcke wie wir so treiben, sagte ich, das würde sie im Moment eher weniger interessieren. Ansonsten sei sie doch ein wundervolles, wohlgeratenes Mädchen, das gerade beginne auf eigenen Beinen zu stehen.
Doch mein Vater wollte das nicht hören. Er wollte überhaupt nichts hören, zuhören war noch nie seine Stärke. Mein Vater wollte bloß etwas loswerden, denn poltern und meckern und andere zurechtweisen, das sind seine großen Stärken.
Anrufen solle die Enkeltochter, sagte mein Vater, und die Stimme schleifte schon ein wenig vom Alkohol, mindestens einmal wöchentlich solle sie anrufen, alles andere interessiere ihn nicht. Was er denn mit ihr zu besprechen habe, wollte ich wissen. Nichts, sagte mein Vater, aber sie solle sich gefälligst melden. Ich sagte, dann solle er sich doch bei ihr melden, wenn er etwas mit ihr zu besprechen habe, was immer das auch sei. Das war der Moment, in dem ich zum Arschloch wurde.
Nicht, dass mich das überrascht hätte. Es war ja nicht das erste Mal.
Ein Arschloch genannt zu werden, das ist zwar nicht gerade Alltag, aber es kommt doch immer wieder vor. Mein Vater hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Wird er doch noch mal sagen dürfen. Nur seine Meinung. Und da mein Vater auch der Meinung ist, dass er immer recht hat, gibt es auch keinen Anlass, sich für irgendetwas zu entschuldigen.
Deswegen verletzt es mich schon lange nicht mehr, ein Arschloch genannt zu werden. Ich bin es ja gewohnt. Und außerdem, das habe ich im Laufe der Jahrzehnte gelernt, bin ich in ausnehmend guter Gesellschaft. Denn die Welt meines Vaters ist bevölkert von Arschlöchern und Idioten. Die Kollegen, die er hatte, bevor er Rentner wurde. Die Freunde, die er seltsamerweise immer noch hat. Politiker sowieso, Künstler, Sportler und Manager, die im Fernsehen generell, und überhaupt die da oben, aber auch die, die gerade im Weg rumstehen, die, die ihre Millionen nicht verdienen, und die, die arm sind, weil sie es nicht besser verdienen. Alles Arschlöcher.
Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater mal über jemanden gesagt hätte: Das ist ein toller Typ. Den kann ich gut leiden. Der ist interessant, schlau oder wenigstens nicht ganz verkehrt. Mehr als friedliche Koexistenz scheint ihm grundsätzlich verdächtig. Jemand, der ihm ein gutes Essen hinstellt, wird dafür nicht gelobt. Über Künstler sagt er, das könne er auch. Ins Theater geht er nicht, weil, was soll er denn da. In der Oper, in die er gehen muss, weil seine Frau da hinwill, schläft er ein. Schwarze sind faul, Juden sind geldgierig, Flüchtlinge wollen nur sein Geld.
Solch ein Weltbild macht auch vor der engsten Verwandtschaft nicht halt. Die eigene Frau hält er für unterbelichtet. Die eigenen Enkelkinder sind ihm zu fett und zu undankbar. Den einen Sohn findet er faul und dumm. Und der andere Sohn, also ich, erhält den Ritterschlag: Der ist ein Arschloch.
Ich bin es also gewohnt. An diesem Abend allerdings traf der altbekannte Vorwurf wieder ins Ziel. Vielleicht weil ich ihn schon länger nicht mehr gehört hatte, vielleicht weil der Wein mich dünnhäutiger gemacht hatte. Also stand das Arschloch auf von der Couch und ging erst einmal raus aus dem Wohnzimmer, raus aus der Situation. Sonst sagt das Arschloch noch etwas, was es später bereuen würde. Was womöglich beweisen könnte, dass das Arschloch tatsächlich ein Arschloch ist.
Ich öffnete die Haustür, trat hinaus, schloss die Tür und setzte mich auf die Stufen. Einen kurzen Moment dachte ich, vielleicht sollte ich wieder mit dem Rauchen anfangen. Jetzt eine Zigarette, das wäre schön. Was anderes zu tun haben. Nicht nachdenken müssen. Dem Rauch nachsehen, die Wärme in der Lunge spüren. Aber nach der einen Zigarette wäre ich ein gewesener Exraucher und mein Vater trotzdem immer noch da.
Ich sah hinaus ins Dunkel. Hinterm Haus standen die Bäume still. Am liebsten wäre ich davongerannt. So lange um den Block gelaufen, bis mein Vater weg war. Aber er wäre nicht weg, wenn ich zurückkäme, er würde immer noch auf der Couch sitzen. Und wenn er nicht mehr auf der Couch säße, wenn er heimgefahren wäre in das Kaff, das auch ich einmal mein Zuhause genannt habe, auch dann wäre er nicht wirklich weg. Mein Vater wird immer bei mir sein, ob ich will oder nicht. Doch, so eine Zigarette wäre jetzt schön.
So als Arschloch fragt man sich natürlich: Muss das sein? Warum tut man sich das noch an? Könnte man so einen Vater nicht einfach zum Teufel jagen? Geht das überhaupt: Kann man sich nicht scheiden lassen von seinen Eltern?
Es sind Fragen, die ich mir schon lange stelle. Sehr lange.
Nicht, dass mein Vater sich selbst großartig finden würde. Ich weiß nicht, wie mein Vater sich selbst findet. Vielleicht hält er sich insgeheim auch für ein Arschloch. Dass er sich selbst hasst, das würde immerhin erklären, warum er den Rest der Welt so hasst. Warum er andere erniedrigen muss, um sich selbst zu erhöhen. Warum mein Vater so ist, wie er ist.
Das Licht über der Haustür ging aus. Solange ich mich nicht rührte und den Bewegungsmelder auslöste, würde es auch nicht wieder angehen. Ich saß im Dunkeln, keiner konnte mich sehen, ich hoffte zu verschwinden und fragte mich: Warum tut man sich das an? Warum verbringt man Zeit mit Menschen, die man am liebsten von hinten sieht? Kann man seine Eltern nicht abschaffen? Dem eigenen Erzeuger kündigen? Die Gefühle, die guten und die schlechten, einfach entsorgen? Endlich Auf Nimmerwiedersehen sagen?
Die Luft war feucht, es hatte geregnet an diesem Abend. Ich wollte nicht wieder zurück. Ich wusste, ich muss. Dieser Mann ist mein Vater. Aber ist er mein Vater? Was ist ein Vater? Ich bin ein Vater. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß, mein Vater weiß es nicht.
Ich wusste, ich muss da wieder rein. Ich wusste, ich kann so lange hier sitzen, wie ich will, mein Vater wird nicht verschwinden. Er wird wieder nach Hause fahren, aber er wird mich nie verlassen. Obwohl – oder gerade weil – ich mich von ihm verlassen fühle.
Draußen auf der Treppe fragte ich mich, über was dort drinnen gerade gesprochen wurde. Wahrscheinlich saß mein Vater still auf der Couch und seine Schwiegertochter versuchte ihm zu erklären, warum man den eigenen Sohn nicht Arschloch nennt. Dass man versucht, Menschen, die man liebt, nicht zu verletzen. Dass ich doch eigentlich ein ganz prima Sohn geworden sei, dass sie das jedenfalls findet, weil sie sonst schon längst nicht mehr mit mir zusammen wäre. Mein Vater aber würde, ich sehe es vor mir, nur mit verschränkten Armen auf der Couch sitzen und seiner Schwiegertochter teilnahmslos in die Augen blicken. Er würde nichts sagen. Er wusste es ja besser. Sein Sohn ist nun mal ein Arschloch, das wird man ja wohl mal sagen dürfen, wenn es doch stimmt.
Ich versuchte mir die Situation vorzustellen, die Kälte kroch mir langsam in die Arschbacken, und ein tiefes, erschütterndes Gefühl der Heimatlosigkeit ergriff mich. Ein Gefühl, das ich nur zu gut kannte. Ja, ich habe eine Familie, die ich mir selbst aufgebaut habe, eine zweite Familie, die lange nicht perfekt, aber sehr viel besser ist als das, was ich kannte, aber trotzdem niemals meine erste Familie werden kann. Wohin, fragte ich mich, gehe ich, wenn alles zusammenfällt? Wer stellt dann keine blöden Fragen, sondern versteht mich auch ohne Worte? Wo ist das Loch, in dem ich mich verstecken kann?
Nicht bei meinen Eltern. Die haben mich schon nicht verstanden, als ich noch versucht habe, mit ihnen zu reden. Alle anderen, so scheint es, besitzen noch eine erste Heimat. Sie wissen, dass sie zu ihren Eltern gehen können, egal, was passiert. Sie wissen, dass es noch ein Zuhause gibt, wenn das Zuhause, das sie sich selbst gebaut haben, zerbrechen sollte. Sicher, ich könnte zurückgehen, dorthin, wo ich herkam. Mein Vater würde die Tür öffnen, meine Mutter würde ein Bett beziehen, aber ich würde nicht nach Hause kommen. Denn ich vertraue meinen Eltern nicht. Mir fehlt dieses Gefühl, ihnen alles sagen zu können und es dort in guten Händen zu wissen. In den Arm genommen zu werden, egal, was ich angestellt habe. Das Gefühl, keine Fehler machen zu können.
Einmal, ein einziges Mal nur, stand mein Vater vor mir und wollte wissen: Was habe ich dir getan? Es war ein trüber Morgen vor einigen Jahren, niemand außer uns beiden wach. Wir standen in der Küche in dem Haus, das mein Vater gebaut hat, an der Wand die weder braunen noch grünen Fliesen, die nach Jahrzehnten immer noch so glänzten, als hätte er sie erst an Tag zuvor angeklebt. Was habe ich verbrochen?, fragte er in einer Mischung aus Verzweiflung und Wut. Was hat mein Sohn gegen mich? Es war mehr Wut als Verzweiflung. Ich versuchte trotzdem, es zu erklären. Ich redete von meinen Gefühlen, von seinem Desinteresse. Ich redete davon, dass ich mich immer missverstanden fühlte, bisweilen sogar ignoriert. Davon, dass er mich und andere klein macht, davon, dass er nie einen Fehler zugegeben habe. Ich redete davon, dass es halt manchmal so ist, dass Menschen nicht miteinander können, auch wenn sie miteinander verwandt sind. Er sagte, er verstehe das nicht, ich solle nicht so daherlabern, sondern doch mal bitte konkret werden und erklären, was ich gegen ihn hätte. In der Küche roch es wie immer nicht nach Essen, sondern nach Putzmittel. Ich fragte ihn, ob er denn schon mal darüber nachgedacht habe, was sein Anteil an unserem gestörten Verhältnis sein könne. Er sagte, genau darüber hätte er nachgedacht, aber keinen Fehler bei sich entdecken können.
So war es immer, dachte ich, während ich draußen saß und fror und versuchte, meine Gefühle zu ordnen. Denn kann ich mich wirklich beschweren über meinen Vater? Kann ich ihm sagen: Du liebst mich nicht? Wenn ich doch weiß, mein Vater würde sagen: Doch, ich liebe dich. Habe ich dir nicht alles gegeben, alles ermöglicht? Hattest du es etwa schlecht? Nein, ich hatte das, was man eine sorgenfreie Kindheit nennt.
Ich kann mir ja denken, ich kann vermuten, wer schuld ist. Die Vergangenheit, die Zeiten, die Umstände. Der Vater meines Vaters und der große Krieg. In einem kleinen Berliner Theater lief jahrzehntelang ein Stück mit dem Titel „Ich bin’s nicht, Adolf Hitler ist es gewesen“. Ich habe das Stück nie gesehen, das Publikum bestand vor allem aus Schulklassen auf Klassenfahrt in Berlin. Aber immer, wenn ich den Titel las, musste ich an meinen Vater denken. An die Sprachlosigkeit und die emotionale Verkrüppelung und Inkompetenz. Adolf war schuld, irgendwie. Eine Erklärung, eine Entschuldigung, aber auch kein wirklich tröstlicher Gedanke.
Denn man ist trotzdem auf ewig mit jemandem zusammengesperrt, mit dem man freiwillig keine zwei Stunden würde verbringen wollen. Mit jemandem, von dem man vor allem weiß, dass man nicht so sein will wie er. Obwohl man ihm so ähnlich ist.
Trotzdem: Ich glaubte, ich hätte ein Verfahren gefunden, mit dem ich den Rest unserer gemeinsamen Tage ohne große Verwerfungen überstehen könnte. Wenn Freunde, deren Eltern gerade gestorben waren, klagten, dass so vieles nicht gesagt worden sei, dass sie sich noch gern versöhnt hätten, gab ich den Abgeklärten. Hätte auch nichts genutzt, sagte ich dann, ich habe meinem Vater alles gesagt, was ich sagen wollte, ich habe ihn einen Rassisten genannt, einen Antisemiten und einen lieblosen Klotz. Und das alles vollkommen zu Recht. Genutzt hat es trotzdem nichts. Es gab keine Entschuldigungen, erst recht keine späte Zuwendung. Es wird sie auch niemals geben. Ich würde sie auch gar nicht mehr haben wollen.
Aber ich muss jetzt wieder da rein. Weil es nun doch zu kalt wird hier draußen auf der Treppe. Weil der Abend irgendwie zu Ende gehen muss. Weil noch jeder Abend irgendwie zu Ende gegangen ist. Weil ich weiß, dass wir die Sache einfach totschweigen werden. Weil der Schmerz und die Wut und die Erinnerungen sowieso niemals verschwinden werden.
Mehr als drei Jahrzehnte arbeite ich mich an meiner Herkunft ab. Immerhin eines habe ich gelernt: Man kann Eltern hassen, verabscheuen und ablehnen. Man kann den Kontakt abbrechen oder ans andere Ende der Welt ziehen. Aber man kann ihnen nicht kündigen. Man kann seine Eltern nicht abschaffen. Auch wenn sie dann eines Tages wirklich weg sein sollten, seine Eltern wird man ein Leben lang nicht mehr los. Damit muss jeder klarkommen. Ich tu’s ja auch.
Ich habe einen Vater.
Ich habe eine Mutter.
Ich habe einen Bruder.
Ich fühle nichts.
Ich bin 49 Jahre alt. Ich bin ein Arschloch.
Ich bin drei Jahre alt, und ich gehe unter, und dies ist meine früheste Kindheitserinnerung. Vielleicht ist es auch nur die Erinnerung anderer. Die meiner Mutter. Die der Mutter meiner Mutter womöglich. Die meines Bruders nicht, der war noch zu klein, noch kleiner als ich, ein Baby. Die meines Vaters auch nicht, der war gar nicht dabei. Jedenfalls nicht in meiner Erinnerung, so porös und unzuverlässig sie sein mag, ob aus zweiter Hand oder doch aus erster.
Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich erinnern kann, erinnern können sollte. Ich war drei Jahre alt. Vielleicht auch erst zwei. Nein, ich muss drei Jahre alt gewesen sein, mindestens drei, denn mein Bruder ist anwesend in dieser Erinnerung, und er kann schon stehen, sogar laufen. Auch wenn ich nicht weiß, woher die Erinnerung kommt, im Laufe der Jahre ist sie ganz sicher zu meiner eigenen geworden. Bruchstücke, einzelne Sätze, Erinnerungsfetzen. Der Rest ist vielleicht bloß meine eigene Fantasie. Details, mit denen ich das wenige ausschmücke, auspolstere, das verbürgt ist in der schmalen Familienüberlieferung einer Familie, in der nie viel gesprochen wurde über das, was war, oder das, was ist. Eine Familie, in der, wenn ich so zurückdenke, überhaupt nie viel gesprochen wurde über das, was wichtig gewesen wäre.
Aber trotz alledem, diese eine Erinnerung in mir ist sehr lebendig. Ich erinnere, wie sich das Wasser schließt über mir. Ich erinnere sogar kleine Schaumkronen. In meiner Erinnerung steigen Luftbläschen auf neben mir. Ich gehe unter.
Über mir die Wasserunterfläche. Nennt man das so? Die Wasseroberfläche von unten. Langsam rückt sie in die Ferne. Ein fremder, ein ungewohnter Anblick, aber, so fühlt sich die Erinnerung an, seltsamerweise kein erschreckender Anblick, eher faszinierend. Das erinnere ich: Ich schaue interessiert nach oben, wie sich das Wasser über mir schließt. Ich habe keine Angst, gar keine. Ich habe Vertrauen. Mir kann nichts passieren. Ich gehe unter, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich sehe das Wasser über mir und neben mir und unter mir. So kann, so muss es gewesen sein.
Wirklich wissen kann ich nicht, ob es so gewesen ist. Es ist nur meine Erinnerung.
Aber ich weiß, dass es das eine Bild gibt. Das Bild ist das Einzige, woran ich mich tatsächlich fest und unwiederbringlich erinnern kann oder vielleicht doch nur erinnern können will. Das Bild der geschlossenen Wasserunterfläche, durch die eine Hand sticht. Das Wasser und die Hand, das sehe ich vor mir, klar und deutlich. Die geschlossene, noch leicht schwappende Wasserfläche, die fünf Finger der Hand, die sich recken. Das ist das erste Bild, an das ich mich zu erinnern glaube. Das ist das Bild, mit dem meine Erinnerungen einsetzen. Das ist der Moment, in dem mir mein Leben beginnt. Als hätte ich erst an diesem Tag, in dieser Sekunde die Augen geöffnet, nicht schon gut drei Jahre zuvor.
Die Hand rettet mich. Sie packt mich am Arm und zieht mich aus dem Wasser. Ich liege neben dem Schwimmbecken auf den Fliesen. Die Fliesen sind kalt. Ich sehe die blinden Fenster des Schwimmbads, ich sehe die schwitzenden Scheiben. Eisblumen von innen. Ich weiß: Wenn man die Hand ans Fenster hält, droht sie festzufrieren. Draußen, hinter den Eisblumen ist tiefster Winter. Meine Mutter ist da, die Mutter meiner Mutter, mein Bruder, der Bademeister, dessen Hand mich aus dem Becken gezogen hat. Mein Vater ist nicht da. In meiner Erinnerung tragen meine Mutter und ihre Mutter, die mein Bruder und ich Großmutter nennen, um sie unterscheiden zu können von der Mutter meines Vaters, die wir Oma nennen, keine Badeanzüge, sondern ganz normale Straßenkleidung, obwohl ich die beiden doch sehe im Schwimmbad neben dem Becken neben mir. Wenn ich so zurückdenke, dann ist es vielleicht doch nur ein Traum.
„Dass er sich unter dem Pseudonym Martin Osterberg noch einmal auf den Weg zurück gemacht hat und die Situation seiner Kindheit und Jugend in der Wohlstandsversorgung beleuchtet, ist eine große Stärke seines Buchs.“
„(…) In lakonischen, oft auch ratlosen Sätzen, die genau da stehen, wo sie hingehören, breitet ein Berliner Journalist unter Pseudonym das fesselnd unspektakuläre Innenleben seiner deutschen Durchschnittsfamilie (…) aus.“




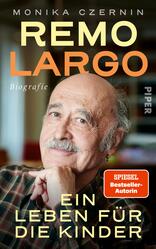



Berührende Familienchronik und gleichzeitig Porträt einer ganzen Generation. Sehr lesenswert!
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.