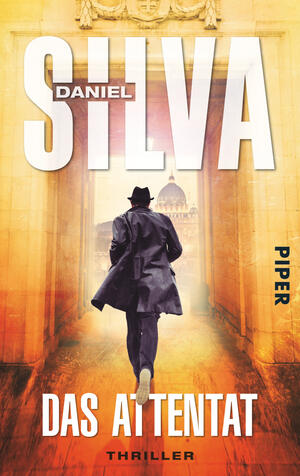
Das Attentat (Gabriel-Allon-Reihe 12)
Thriller
„Silva (...) sorgt für Dauerspannung.“ - Recklinghäuser Zeitung
Das Attentat (Gabriel-Allon-Reihe 12) — Inhalt
Gabriel Allon hat Zuflucht hinter den schweigsamen Mauern des Vatikans gefunden und beginnt gerade mit der Restauration eines alten Caravaggio, als der Privatsekretär des Papstes ihn in den Petersdom ruft: Unter der prächtigen Kuppel liegt eine tote Frau – und das Geheimnis, das sie mit in den Tod genommen hat, könnte die ganze Welt in einen Konflikt apokalyptischen Ausmaßes stürzen …
Leseprobe zu „Das Attentat (Gabriel-Allon-Reihe 12)“
Teil I
STADT DER TOTEN
1
VATIKANSTADT
Es war Nicolò Moretti, der Kustos des Petersdoms, der die Entdeckung machte, mit der alles begann. Das war um 6.24 Uhr morgens, aber wegen eines unbeabsichtigten Zahlendrehers wurde in der ersten offiziellen Mitteilung des Vatikans als Uhrzeit 6.42 Uhr angegeben. Diese war nur eine der zahlreichen großen und kleinen Fehlinformationen, aus denen man schloss, der Heilige Stuhl habe etwas zu verbergen, was auch tatsächlich der Fall war. Die römisch-katholische Kirche, sagte später ein bekannter Kirchenkritiker, sei nur [...]
Teil I
STADT DER TOTEN
1
VATIKANSTADT
Es war Nicolò Moretti, der Kustos des Petersdoms, der die Entdeckung machte, mit der alles begann. Das war um 6.24 Uhr morgens, aber wegen eines unbeabsichtigten Zahlendrehers wurde in der ersten offiziellen Mitteilung des Vatikans als Uhrzeit 6.42 Uhr angegeben. Diese war nur eine der zahlreichen großen und kleinen Fehlinformationen, aus denen man schloss, der Heilige Stuhl habe etwas zu verbergen, was auch tatsächlich der Fall war. Die römisch-katholische Kirche, sagte später ein bekannter Kirchenkritiker, sei nur noch einen Skandal vom Untergang entfernt. Was der Heilige Vater jetzt am wenigsten brauchen konnte, war eine Leiche im Vatikan, dem Herzen der Christenheit.
Nicolò Moretti hatte natürlich auch keinen Skandal erwartet, als er an diesem Morgen eine Stunde früher als gewöhnlich in den Petersdom kam. In seiner dunklen Hose und dem knielangen grauen Arbeitskittel war er kaum zu sehen, als er über den im Dunkel liegenden Petersplatz zu den Stufen des Doms hastete. Ein Blick nach rechts zeigte ihm, dass im zweiten Stock des Apostolischen Palasts Licht brannte. Seine Heiligkeit, Papst Paul VII., war schon wach. Moretti fragte sich, ob der Heilige Vater überhaupt geschlafen hatte. Im Vatikan gingen Gerüchte um, er leide derzeit an schwerer Schlaflosigkeit und verbringe die Nächte meist schreibend in seinem Arbeitszimmer oder gehe in den Vatikanischen Gärten spazieren. Das kannte der Kustos schon. Im Lauf der Zeit litten sie alle unter Schlaflosigkeit.
Moretti hörte Stimmen hinter sich, sah sich um und beobachtete, wie zwei Kuriengeistliche aus dem Halbdunkel auftauchten. Sie unterhielten sich angeregt und achteten nicht auf ihn, während sie in Richtung Heilige Pforte weitermarschierten und wieder mit den Schatten verschmolzen. Bei den römischen Kindern hießen sie Bagarozzi – schwarze Käfer. Auch Moretti hatte diesen Ausdruck in seiner Kindheit benutzt und war dafür von niemand Geringerem als Papst Pius XII. gescholten worden. Seitdem hatte er ihn nie wieder in den Mund genommen.
Moretti stieg die Stufen zum Dom hinauf und trat in den Portikus. Von hier führten fünf Portale ins Kirchenschiff, aber nur das Südportal außen links, das sogenannte Todesportal, war geöffnet. Dort stand Pater Jacobo, ein hagerer mexikanischer Geistlicher mit strohigem grauen Haar. Er trat zur Seite, um Moretti einzulassen, schloss dann die Tür und legte den massiven Sperrbalken vor. „Ich bin um sieben wieder hier, um Ihre Männer einzulassen“, sagte der Geistliche. „Seien Sie dort oben vorsichtig, Nicolò. Sie sind auch nicht mehr der Jüngste.“
Der Geistliche zog sich zurück. Moretti tauchte zwei Finger ins Weihwasser und bekreuzigte sich, bevor er durch das riesige Kirchenschiff weiterging. Wo andere vielleicht ehrfürchtig staunend stehen geblieben wären, bewegte Moretti sich mit der Vertrautheit eines Mannes, der das eigene Heim betritt. Als Chef der sogenannten Sanpietrini, der kirchlichen Haustechniker, betrat er seit siebenundzwanzig Jahren an sechs Tagen in der Woche frühmorgens den Petersdom. Es war Moretti und seinen Männern zu verdanken, dass die Basilika in himmlischem Licht erstrahlte, während die meisten anderen Dome und Kathedralen Europas in mystischem Halbdunkel lagen. Moretti sah sich nicht nur als Diener des Papsttums, sondern auch als Partner eines gemeinsamen Unternehmens. Den Päpsten war die Sorge für eine Milliarde Katholiken anvertraut, und Nicolò Moretti betreute die gewaltige Basilika, die ihre weltliche Macht symbolisierte. Vom Scheitelpunkt der Kuppel bis zu den Tiefen der Krypta kannte er jeden Quadratzentimeter der Kirche – ihre vierundvierzig Altäre, siebenundzwanzig Kapellen, achthundert Säulen, vierhundert Statuen und dreihundert Fenster. Er wusste, wo sie Risse hatte und wo sie undicht war. Er wusste, wann es ihr gut oder schlecht ging. Wenn die Basilika sprach, flüsterte sie in Nicolò Morettis Ohr.
Die riesenhaften Abmessungen des Petersdoms ließen normale Sterbliche schrumpfen, und so erinnerte Moretti in seiner Dienstkleidung auf dem Weg zum Papstaltar an einen zum Leben erweckten Fingerhut. Er beugte das Knie vor der Confessio, dann richtete er den Blick nach oben. Fast dreißig Meter über ihm befand sich der auf vier gedrehten Bronzesäulen ruhende majestätische Baldachin. An diesem Morgen war er teilweise durch ein Aluminiumgerüst verdeckt. Berninis Meisterwerk mit seinem Figurenschmuck und den kunstvoll gearbeiteten Oliven- und Lorbeerzweigen zog Staub und Weihrauch geradezu magisch an. Deshalb reinigten Moretti und seine Männer es jedes Jahr, und zwar eine Woche vor Beginn der Fastenzeit. Der Vatikan war ein Ort zeitloser Rituale, und auch für die Reinigung des Baldachins gab es eines. Moretti selbst hatte festgelegt, dass er das Gerüst als Erster besteigen werde, sobald es stehe. Den Blick von oben kannten nur wenige Menschen – und als Chef der Sanpietrini bestand Nicolò Moretti auf dem Vorrecht, ihn als Erster zu genießen.
Moretti stieg zum Kapitell der vorderen Säule hinauf, hakte seine Sicherheitsleine ein und kroch auf allen vieren den Baldachin hinauf. Den Scheitelpunkt bildete eine von einem Kreuz gekrönte Kugel auf vier Ständern. Dies war der heiligste Punkt der Basilika St. Peter, der sich in genau senkrechter Linie über dem Grab des Apostels Petrus befand. Es symbolisierte die Grundidee, auf der das ganze Unternehmen basierte: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen.“ Als die ersten dämmrigen Lichtstrahlen das Innere der Basilika erhellten, konnte Moretti fast spüren, wie der Finger Gottes seine Schulter berührte. Wie gewöhnlich verlor er dort oben jegliches Zeitgefühl. Als er später von der Vatikanpolizei befragt wurde, konnte er sich nicht genau erinnern, wie lange er schon auf dem Baldachin gewesen war, als er den Gegenstand unter sich entdeckte. Von Morettis hoher Warte aus glich er einem Vogel mit gebrochenen Flügeln. Er hielt ihn zunächst für etwas Harmloses: für eine von einem anderen Sanpietrino vergessene Plane oder vielleicht für ein Schultertuch, das eine Touristin verloren hatte. Die Besucher ließen dauernd irgendwelche Sachen liegen, darunter auch Dinge, die in einer Kirche nichts zu suchen hatten.
Trotzdem musste er sich diesen Gegenstand ansehen, und so kehrte Moretti vorsichtig um und begann den langen Abstieg. Unten im Querschiff erkannte er schon nach wenigen Schritten, dass dort keine Plane und erst recht kein Schultertuch lag. Als er näher kam, sah er auf dem Marmorboden seiner Basilika angetrocknetes Blut und ein Augenpaar, das mit so leerem Blick in die Kuppel starrte wie die vierhundert Statuen des Petersdoms. „Herr im Himmel“, flüsterte Moretti, als er durchs Kirchenschiff zurückhastete, „sei ihrer armen Seele gnädig.“
Von den Ereignissen, die unmittelbar auf Nicolò Morettis Entdeckung folgten, erfuhr die Öffentlichkeit nur wenig, denn sie fanden nach alter Vatikantradition unter striktester Geheimhaltung und mit einer Prise jesuitischer Listigkeit statt. Beispielsweise sollte niemand außerhalb der Mauern jemals wissen, dass Moretti als Erstes den Kardinalrektor des Petersdoms aufsuchte: einen strengen Kölner mit gesundem Selbsterhaltungstrieb. Der Kardinal war erfahren genug, um potenzielle Unannehmlichkeiten zu wittern, weshalb er den Vorfall nicht der Polizei meldete, sondern stattdessen den wahren Hüter des Gesetzes im Vatikan verständigte.
So kam es, dass Nicolò Moretti fünf Minuten später Zeuge einer sehr ungewöhnlichen Szene wurde, als der Privatsekretär Seiner Heiligkeit Papst Pauls VII. die Taschen der Toten auf dem Marmorboden der Basilika durchsuchte. Der Monsignore nahm einen einzigen Gegenstand mit, als er in den Apostolischen Palast zurückkehrte. Es würde zwei parallele Ermittlungen geben müssen, beschloss er in seinem Arbeitszimmer – eine für die Öffentlichkeit bestimmte, die andere für ihn selbst. Und damit die privaten Nachforschungen Erfolg hätten, würden sie von einem besonders vertrauenswürdigen Ermittler angestellt werden müssen. Wenig überraschend war, dass der Monsignore als seinen Inquisitor einen Mann wählte, der große Ähnlichkeit mit ihm selbst hatte. Einen gefallenen Engel in Schwarz. Einen Sünder in der Stadt der Heiligen.
2
PIAZZA DI SPAGNA, ROM
Der Restaurator zog sich lautlos und im Dunklen an, um die Frau nicht zu wecken. Wie sie mit ihrem zerzausten rotbraunen Haar und den sinnlich vollen Lippen dalag, erinnerte sie ihn an Modiglianis Liegenden Akt. Er legte eine geladene Beretta neben sie aufs Bett. Dann zog er die Steppdecke etwas herunter, bis ihre schweren Brüste sichtbar wurden. Das Meisterwerk war perfekt.
Irgendwo in der Nähe läutete eine Kirchenglocke. Aus dem Bett kam eine warme Hand hervor und zog den Restaurator herab. Die Frau küsste ihn wie immer mit geschlossenen Augen. Ihr Haar duftete nach Vanille. Auf ihren Lippen schmeckte er noch eine Spur von dem Wein, den sie am Vorabend in einem Restaurant auf dem Aventinischen Hügel getrunken hatten. Sie ließ ihn los, murmelte etwas Unverständliches und schlief wieder ein. Der Restaurator deckte sie zu. Dann steckte er eine weitere Beretta hinten in den Hosenbund seiner Jeans und verließ leise die Wohnung.
Unten glänzte der Asphalt der Via Gregoriana im ersten Morgenlicht wie ein frisch gefirnisstes Gemälde. Der Restaurator blieb noch einen Augenblick im Hauseingang stehen und gab vor, auf sein Handy zu sehen. Er brauchte nur wenige Sekunden, um den Mann in dem Lancia zu entdecken, der ihn beobachtete. Der Restaurator winkte ihm freundlich zu, unter Profis eine schlimme Beleidigung, und ging in Richtung der Kirche Trinità dei Monti davon.
Oben an der Spanischen Treppe fütterte eine alte Frau mit Kopftuch und in schäbigem Mantel ein Rudel abgemagerter Katzen, die ihr um die Füße strichen. Sie beobachtete den Restaurator misstrauisch, als er an ihr vorbei zur Piazza hinunterging. Er war knapp einen Meter siebzig groß und hatte den sehnigen Körperbau eines Radrennfahrers. Sein Gesicht war lang und schmal mit hohen Wangenknochen und einer wie aus Holz geschnitzten schmalen Nase. Die Augen leuchteten fast unnatürlich grün, sein Haar war schwarz und an den Schläfen grau meliert. Seinem Gesicht war nicht anzusehen, aus welchem Land er stammte, und der Restaurator war sprachbegabt genug, um diese Tatsache entsprechend nutzen zu können.
In seiner langen Karriere hatte er in Italien und anderswo unter zahlreichen Decknamen und Nationalitäten gearbeitet. Die italienischen Sicherheitsbehörden, die seine Biografie kannten, hatten ihm die Einreise verbieten wollen, sie aber nach dezenter Intervention des Heiligen Stuhls doch gestattet. Aus nie ganz geklärten Gründen war der Restaurator vor einigen Jahren im Vatikan gewesen, als dieser von islamischen Terroristen angegriffen worden war. An jenem Tag waren über siebenhundert Menschen umgekommen, darunter vier Kardinäle und acht Kurienbischöfe. Der Heilige Vater selbst war nur leicht verwundet worden. Auch er hätte unter den Opfern sein können, hätte der Restaurator ihn nicht im letzten Moment vor einem Geschoss in Sicherheit gebracht.
Die Italiener hatten an die Rückkehr des Restaurators zwei Bedingungen geknüpft: Er müsse unter seinem Klarnamen im Land leben und damit einverstanden sein, gelegentlich überwacht zu werden. Die erste Bedingung akzeptierte er mit gewisser Erleichterung, denn nach einem Leben auf geheimen Schlachtfeldern sehnte er sich danach, seine vielen Decknamen abzulegen und ein andeutungsweise normales Leben zu führen. Die zweite Bedingung hatte sich jedoch als lästig erwiesen. Zu seiner Beschattung wurden nämlich junge Agenten in der Ausbildung eingeteilt. Anfangs war der Restaurator fast beleidigt gewesen – bis er erkannte, dass er als Übungsobjekt eines Meisterkurses in Überwachungstechniken diente. Er tat seinen Studenten den Gefallen, sie gelegentlich abzuschütteln, behielt aber einige seiner besten Tricks in Reserve – für den Fall, dass die Umstände ihn zwingen sollten, durch die Maschen des italienischen Netzes zu schlüpfen.
So kam es, dass er auf seinem Weg durch die noch ruhigen Straßen Roms von nicht weniger als drei Jungagenten des italienischen Geheimdiensts beschattet wurde. Seine Route, die ihn nach Westen durch die Stadt führte und wie üblich am Annentor endete, dem Geschäftseingang des Vatikans, stellte sie vor wenig Herausforderungen und brachte keinerlei Überraschungen. Weil der Restaurator dort theoretisch eine internationale Grenze überschritt, blieb den Beschattern nichts anderes übrig, als ihn der Obhut der Schweizergardisten zu überlassen, die ihn nach einem kurzen Blick auf seinen Dienstausweis einließen.
Der Restaurator verabschiedete sich von den Beschattern, indem er seine Mütze lüftete, dann folgte er der Via Belvedere – vorbei an der buttergelben St.-Annen-Kirche, der Druckerei des Vatikans und der Zentrale der Vatikanbank. An der Hauptpost wandte er sich nach rechts und durchschritt mehrere Innenhöfe, bis er eine unbezeichnete Tür erreichte. Dahinter lag ein winziger Vorraum, in dem ein Gendarm des Vatikans in einem Glaskasten saß.
„Wo ist Ihr Kollege, der sonst hier Dienst tut?“, fragte der Restaurator in perfektem Italienisch.
„Lazio hat gestern Abend gegen Milan gespielt“, antwortete der Gendarm apathisch und zuckte mit den Schultern.
Er zog den Dienstausweis des Restaurators durch den Kartenleser und bedeutete ihm, durch die Sicherheitsschleuse zu gehen. Als das Gerät schrill piepste, blieb der Restaurator stehen und nickte müde zum Computer des Gendarmen hinüber. Auf dem Bildschirm erschien neben dem Passfoto des Restaurators eine Sonderanweisung vom Chef des vatikanischen Sicherheitsdiensts. Der Gendarm las sie zweimal, um sicherzugehen, dass er sie auch richtig verstanden hatte. Als er wieder aufsah, starrte er direkt in die ungewöhnlich grünen Augen des Restaurators. Irgendetwas an seinem ruhigen Gesichtsausdruck, vielleicht die Andeutung eines schelmischen Lächelns, ließ den Gendarmen unwillkürlich schaudern. Er wies mit dem Kopf zur nächsten Doppeltür und beobachtete aufmerksam, wie der Restaurator sie geräuschlos öffnete und durchschritt.
Dann stimmt das Gerücht also, dachte der Gendarm: Gabriel Allon, berühmter Restaurator von Altmeistergemälden, israelischer Spion und Auftragskiller im Ruhestand sowie Retter des Heiligen Vaters, war in den Vatikan zu„rückgekehrt. Mit einem einzigen Tastenbefehl entfernte er die Datei vom Bildschirm. Dann bekreuzigte er sich und sprach erstmals seit Jahren wieder das Reuegebet. Eine merkwürdige Reaktion, fand er selbst, denn seine einzige Sünde war Neugier gewesen, und die würde ihm bestimmt vergeben werden. Schließlich passierte es nicht jeden Tag, dass ein einfacher Gendarm im Vatikan eine lebende Legende zu Gesicht bekam.
Die Leuchtstoffröhren summten leise, als Gabriel das Konservierungslabor der Vatikanischen Pinakothek betrat. Wie gewöhnlich kam er als Erster. Er schloss die Tür, wartete das beruhigende Klicken der automatischen Verriegelung ab und ging dann an einer langen Reihe von Schränken vorbei, bis er zu den schwarzen Vorhängen kam, die den rückwärtigen Teil des Raums abschlossen. Ein kleines Schild verwies darauf, dass der Zutritt zu diesem Bereich streng verboten sei.
Gabriel schlüpfte durch die Vorhänge, trat an den Werkzeugwagen und überprüfte die Position seines Materials. Die Behälter mit Pigmenten und Malmitteln standen so da, wie er sie zurückgelassen hatte. Unverändert war auch die Position seiner Zobelhaarpinsel von Winsor&Newton, darunter auch die des Pinsels mit einem Tropfen Azurblau an der Spitze, den er immer in einem Winkel von genau dreißig Grad über die anderen legte. Alles zusammen bestätigte, dass das Reinigungspersonal der Versuchung widerstanden hatte, seinen Arbeitsplatz zu betreten. Dass seine Kollegen ähnlich zurückhaltend gewesen waren, bezweifelte er allerdings. Tatsächlich wusste er aus zuverlässiger Quelle, dass seine winzige Enklave der Espressomaschine im Pausenraum den Rang als beliebtester Treffpunkt des Museumspersonals abgelaufen hatte.
Er zog seine Lederjacke aus und schaltete zwei Halogenlampen ein. Die Grablegung Christi, nach weit verbreiteter Ansicht das beste Werk Caravaggios, leuchtete in dem starken weißen Licht. Gabriel stand mehrere Minuten lang mit leicht zur Seite geneigtem Kopf vor dem riesigen Altarbild. Nikodemus, muskulös und barfuß, schien den Blick des Betrachters zu erwidern, während er den blassen Leichnam Christi behutsam auf die Steinplatte legte, auf der er für die Beisetzung vorbereitet werden sollte. Behilflich war ihm der Apostel Johannes, der, um seinen geliebten Lehrer ein letztes Mal zu berühren, in dessen Seitenwunde griff. Die beiden Männer wurden von der Muttergottes und Maria Magdalena schweigend beobachtet, während im Hintergrund die Maria des Kleophas verzweifelt die Arme gen Himmel reckte. Ein Gemälde voller Trauer und Zärtlichkeit, das durch Caravaggios revolutionären Gebrauch von Licht besonders wirkungsvoll war. Selbst Gabriel, der seit Wochen daran arbeitete, hatte ständig das Gefühl, ungewollt einen Augenblick intimen Schmerzes zu stören.
Das Altarbild war im Lauf der Jahre nachgedunkelt, vor allem am linken Rand, wo früher der Eingang des Grabes deutlich zu sehen gewesen war. Manche im italienischen Kunstestablishment – darunter auch Giacomo Benedetti, der berühmte Caravaggisto vom Istituto Centrale per il Restauro – fragten sich, ob es richtig sei, das Grab wieder hervorzuheben. Benedetti hatte sich gezwungen gesehen, sich in der Zeitung La Repubblica dazu zu äußern, weil der beauftragte Restaurator unverständlicherweise darauf verzichtet hatte, vor Arbeitsbeginn seinen Rat einzuholen. Außerdem fand Benedetti es befremdlich, dass das Museum sich weigerte, den Namen des Restaurators bekannt zu geben. Die Zeitungen veröffentlichten tagelang flammende Appelle, der Vatikan solle endlich sein Schweigen brechen. Wie sei es möglich, schäumten sie, einen nationalen Kunstschatz wie Die Grablegung Christi einem Mann ohne Namen anzuvertrauen?
Dieser Sturm im Wasserglas klang schließlich ab, als Antonio Calvesi, der Chefkonservator des Vatikans, mitteilte, der Restaurator sei ein Mann mit makellosen Referenzen, dem der Heilige Stuhl bereits zwei meisterhafte Restaurierungen verdanke: Guido Renis Kreuzigung des hl. Petrus und Nicolas Poussins Martyrium des hl. Erasmus. Allerdings verschwieg Calvesi, dass beide Restaurierungen, die in einer abgelegenen Villa in Umbrien vorgenommen worden waren, sich verzögert hatten, weil der Restaurator zwischendurch für den israelischen Geheimdienst im Einsatz gewesen war.
Gabriel hatte gehofft, auch den Caravaggio irgendwo auf dem Land restaurieren zu können, aber Calvesis Entscheidung, das Gemälde müsse im Vatikan bleiben, ließ ihm keine andere Wahl, als hier im Labor inmitten der Festangestellten zu arbeiten. Er stand im Mittelpunkt intensiver Neugier, aber das war nicht anders zu erwarten gewesen. Sie hatten ihn viele Jahre lang für einen ungewöhnlich begabten, wenn auch launischen Restaurator namens Mario Delvecchio gehalten – um nun zu erfahren, dass er jemand ganz anderes war. Immerhin ließen sie sich nichts anmerken, falls sie sich getäuscht fühlen mochten.
Tatsächlich behandelten sie ihn mit dem Zartgefühl, das Menschen angeboren zu sein scheint, die beschädigte Dinge wieder instand setzen. In seiner Anwesenheit waren sie leise, sie respektierten sein Bedürfnis, ungestört zu arbeiten, und sahen ihm nie lange in die Augen, als fürchteten sie, was darin zu finden sein mochte. Sprachen sie ihn an, was selten vorkam, blieben ihre Bemerkungen auf allgemeine Höflichkeiten oder Kunstthemen beschränkt. Und wenn es in Bürogesprächen um Themen wie Nahostpolitik ging, verzichteten sie auf scharfe Kritik an seinem Heimatland. Nur Enrico Bacci, der für die Restaurierung des Caravaggios getrommelt hatte, war aus moralischen Gründen gegen Gabriels Anwesenheit. Er bezeichnete den schwarzen Vorhang als „Grenzzaun“ und hängte ein Poster mit der Forderung „Befreit Palästina!“ an die Wand seines winzigen Büros.
Gabriel kippte einen kleinen Schuss Mowolith 20 Medium auf seine Palette, fügte einige Körner Trockenpigment hinzu und verdünnte die Mischung mit Acrosolve, bis die gewünschte Konsistenz und Leuchtkraft erreicht war. Dann setzte er seine Lupenbrille auf und konzentrierte sich auf die rechte Hand Christi. Seit Tagen versuchte er, einige Abschürfungen an den Fingerknöcheln zu reparieren. Caravaggio hatte fünf andere Versionen des Werks gemalt, bevor er diese im Jahr 1604 fertiggestellt hatte. Im Gegensatz zu seiner vorhergehenden Auftragsarbeit – der Tod Mariens wurde schon bald wieder aus der Kirche Santa Maria della Scala entfernt – galt Die Grablegung sofort als Meisterwerk, und Caravaggios Ruhm verbreitete sich in ganz Europa. Im Jahr 1797 wurde Napoleon Bonaparte, einer der größten Kunsträuber der Geschichte, auf das Gemälde aufmerksam und ließ es über die Alpen nach Paris karren. Dort blieb es, bis es 1817 zurückgegeben und in die Gemäldesammlung des Vatikans aufgenommen wurde.
Einige Stunden lang hatte Gabriel das Labor für sich allein. Erst gegen zehn Uhr hörte er die Schlösser einrasten, bevor Enrico Baccis schwere Schritte erklangen. Nach ihm kam Donatella Ricci, eine auf die Frührenaissance spezialisierte Restauratorin, die im Flüsterton mit den ihr anvertrauten Gemälden sprach. Als Nächster traf Tommaso Antonelli ein, einer der Stars bei der Restaurierung der Sixtinischen Kapelle, der auf Kreppsohlen so leise wie ein nächtlicher Dieb durchs Labor schlich.
Um halb elf hörte Gabriel dann das typische Geräusch von Antonio Calvesis handgenähten Schuhen auf dem Linoleumboden. Einige Sekunden später kam Calvesi durch die schwarzen Vorhänge gewirbelt wie ein Matador. Mit seiner in die Stirn fallenden Locke und der stets gelockerten Krawatte sah er aus, als wäre er auf dem Weg zu einem lästigen Termin. Er setzte sich auf einen hohen Hocker und knabberte nachdenklich am Bügel seiner Lesebrille, während er Gabriels Arbeit begutachtete.
„Nicht übel“, sagte er ehrlich bewundernd. „Warst du das – oder ist Caravaggio vorbeigekommen, um die Ausbesserung selbst vorzunehmen?“
„Ich habe ihn um Hilfe gebeten“, antwortete Gabriel, „aber er konnte nicht kommen.“
„Wirklich? Wo war er denn?“
„Im Gefängnis Tor di Nona. Offenbar ist er auf dem Campo Marzio mit blankem Degen herumgelaufen.“
„Schon wieder?“ Calvesi beugte sich etwas nach vorn. „An deiner Stelle würde ich überlegen, ob das Craquelé am rechten Zeigefinger wiederhergestellt werden sollte.“
Gabriel schob die Lupenbrille hoch und bot Calvesi seine Palette an. Der Italiener wies sie lächelnd zurück. Obwohl er selbst ein begabter Restaurator war – in ihrer Jugend waren die beiden sogar Konkurrenten gewesen –, hatte er seit vielen Jahren nicht mehr praktisch gearbeitet. Heutzutage verbrachte Calvesi den größten Teil seiner Arbeitszeit mit der Suche nach Geldquellen. Trotz seiner irdischen Reichtümer war der Vatikan für den Unterhalt seiner außergewöhnlichen Kunst- und Antiquitätensammlungen auf fremdes Geld angewiesen. Auch Gabriels kümmerliches Honorar betrug nur einen Bruchteil dessen, was er bei privaten Restaurierungen verdiente. Das war jedoch ein geringer Preis für die einmalige Chance, ein Meisterwerk wie Die Grablegung restaurieren zu dürfen.
„Glaubst du, dass du irgendwann damit fertig wirst?“, fragte Calvesi. „Ich möchte es zur Heiligen Woche wieder in der Galerie haben.“
„Wann ist die dieses Jahr?“
„Ich werde so tun, als hätte ich das nicht gehört.“ Calvesi spielte geistesabwesend mit den Utensilien auf Gabriels Wagen.
„Hast du irgendwas auf dem Herzen, Antonio?“
„Einer unserer wichtigsten Gönner besucht morgen das Museum. Ein Amerikaner. Stinkreich. Einer von den Leuten, die dazu beitragen, dass wir hier arbeiten können.“
„Und?“
„Er möchte gern den Caravaggio sehen. Und er hat gefragt, ob jemand bereit wäre, ihm einen kurzen Vortrag über die Restaurierung zu halten.“
„Hast du wieder Aceton geschnüffelt, Antonio?“
„Darf er ihn nicht wenigstens sehen?“
„Nein.“
„Warum nicht?“
Gabriel betrachtete einen Augenblick lang schweigend das Gemälde. „Weil es ihm gegenüber nicht fair wäre“, sagte er schließlich.
„Dem Gönner gegenüber?“
„Nein, Caravaggio. Die Restaurierung soll unser kleines Geheimnis bleiben, Antonio. Unser Job ist es, unsichtbar zu bleiben und unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu arbeiten.“
„Was ist, wenn ich Caravaggio selbst um Erlaubnis bitte?“
„Frag ihn lieber nicht, wenn er gerade seinen Degen in der Hand hat.“ Gabriel setzte die Lupenbrille wieder auf und arbeitete weiter.
„Weißt du, Gabriel, du bist genau wie er. Stur, eingebildet und viel begabter, als dir guttut.“
„Kann ich sonst noch irgendwas für dich tun?“, fragte Gabriel und klopfte ungeduldig mit dem Pinsel an die Palette.
„Nicht für mich“, antwortete Calvesi, „aber du sollst in die Kapelle kommen.“
„Welche Kapelle?“
„Die einzige, die wichtig ist.“
Gabriel wischte den Pinsel ab und legte ihn sorgfältig an seinen Platz zurück.
Calvesi lächelte. „Du hast einen weiteren Charakterzug mit unserem Freund Caravaggio gemein.“
„Welchen denn?“
„Du leidest unter Verfolgungswahn.“
„Caravaggio hatte gute Gründe, paranoid zu sein. Genau wie ich.“
3
SIXTINISCHE KAPELLE, VATIKAN
Die 548 Quadratmeter große Sixtinische Kapelle ist vermutlich das meistbesuchte Gebäude Roms. Tagtäglich strömen mehrere Tausend Touristen durch ihre eher schlichten Türen und verrenken sich die Hälse, um die herrlichen Fresken an Wänden und Decken zu bewundern. Dabei werden sie von blau uniformierten Gendarmen überwacht, die nur die Aufgabe zu haben scheinen, ständig um Silenzio zu bitten. Ganz allein in der Kapelle zu stehen bedeutet jedoch, sie so zu erleben, wie Papst Sixtus IV., ihr Namensgeber, es beabsichtigt hatte. Bei gedämpftem Licht meint man fast, die Streitigkeiten früherer Konklaven zu hören oder Michelangelo auf seinem Gerüst zu sehen, wie er mit einigen Pinselstrichen Die Erschaffung Adams fertigstellt.
Die Westwand der Kapelle nimmt das zweite sixtinische Meisterwerk des Künstlers ein, Das Jüngste Gericht. Es wurde dreißig Jahre nach den Deckenfresken begonnen und zeigt die Apokalypse und die Wiederkunft Christi, bei der sich die Menschenseelen in einem Wirbel aus Farbe und Schmerz erheben oder aber fallen, um ihren ewigen Lohn oder die ewige Strafe zu erhalten.
Dieses Fresko sehen die Kardinäle als Erstes, wenn sie die Kapelle betreten, um einen neuen Papst zu wählen, und an diesem Morgen schien es die ganze Aufmerksamkeit eines einzelnen Geistlichen zu beanspruchen. Er war groß und schlank, sah blendend aus und trug eine maßgeschneiderte schwarze Soutane mit purpurroter Schärpe von einem Schneider in der Nähe des Pantheons. Seine dunklen Augen kündeten von scharfer, kompromissloser Intelligenz, während sein energisches Kinn darauf schließen ließ, dass es gefährlich sein konnte, sich mit ihm anzulegen, was auch die Wahrheit war. Monsignore Luigi Donati, Privatsekretär Seiner Heiligkeit Papst Pauls VII., hatte im Vatikan kaum Freunde, nur gelegentliche Verbündete und Erzrivalen. Diese nannten ihn oft „einen kirchlichen Rasputin“, „die wahre Macht hinter dem päpstlichen Thron“ oder „den schwarzen Papst“ – ein wenig schmeichelhafter Hinweis auf seine Vergangenheit als Jesuit. Donati störte das nicht. Obwohl er eifrig Ignatius und Augustinus studiert hatte, neigte er dazu, sich Rat bei dem weltlichen Philosophen Machiavelli zu holen, der einmal gesagt hatte, für einen Fürsten sei es besser, gefürchtet als geliebt zu werden.
Zu den vielen Verfehlungen Donatis, zumindest in den Augen einiger Angehöriger des geschwätzigen päpstlichen Hofs, gehörte seine ungewöhnliche Freundschaft mit dem berüchtigten Spion und Auftragskiller Gabriel Allon. Ihre Partnerschaft trotzte Geschichte und Glauben: Donati, der Soldat Christi, und Gabriel, ein Mann der Kunst, dem der Zufall seiner Geburt ein geheimes Leben voller Gewalt aufgezwungen hatte. Trotz dieser offensichtlichen Unterschiede hatten sie viel gemeinsam. Beide lebten nach hohen moralischen Prinzipien, und beide glaubten, wichtige Dinge ließen sich am besten privat abhandeln. Im Lauf ihrer langen Freundschaft hatte Gabriel den Vatikan beschützt, aber auch einige seiner dunkelsten Geheimnisse aufgedeckt – und Donati war sein williger Komplize gewesen. So hatten die beiden Männer viel dazu beigetragen, die belasteten Beziehungen zwischen den Katholiken der Welt und den Juden, ihren entfernten spirituellen Verwandten, zu entspannen.
Gabriel blieb wortlos neben Donati stehen und betrachtete DasJüngste Gericht. Fast in der Bildmitte, neben dem linken Fuß Christi, befand sich eines der beiden Selbstporträts, die Michelangelo in den Fresken versteckt hatte. Er hatte sich als der heilige Bartholomäus dargestellt, der seine abgezogene Haut in den Händen hielt – eine nicht gerade subtile Antwort auf zeitgenössische Kritiker seiner Arbeit.
„Ich nehme an, dass Sie schon mal hier waren“, sagte Donati, dessen sonore Stimme durch die Kapelle hallte.
„Nur einmal“, erwiderte Gabriel nach kurzer Pause. „Im Herbst 1972, lange vor der Restaurierung. Damals war ich als angeblicher deutscher Student in Europa unterwegs. Ich bin nachmittags hergekommen und geblieben, bis die Aufseher mich zum Gehen genötigt haben. Am nächsten Tag…“
Er brachte den Satz nicht zu Ende. Am Tag danach hatte Gabriel, dem Michelangelos Vision vom Ende der Welt noch deutlich vor Augen stand, ein tristes Mietshaus an der Piazza Annibaliano betreten. Vor dem Aufzug hatte ein hagerer Palästinenser namens Wadal Zwaiter mit einer Flasche Feigenwein in der einen Hand und einem Exemplar von Tausendundeine Nacht in der anderen gewartet. Der Palästinenser gehörte der Terrororganisation Schwarzer September an, die das Münchner Olympiamassaker verübt hatte, und war dafür in einem Geheimprozess zum Tod verurteilt worden. Gabriel hatte Zwaiter ruhig aufgefordert, laut seinen Namen zu sagen. Dann hatte er elf Schüsse auf ihn abgegeben – einen für jeden der in München ermordeten Israelis.
In den folgenden Monaten hatte Gabriel weitere fünf Angehörige des Schwarzen Septembers hingerichtet, was der Auftakt zu einer ruhmreichen Laufbahn gewesen war, die weit länger gedauert hatte, als er jemals beabsichtigt hatte. Im Auftrag des legendären Chefspions Ari Schamron hatte er eines der berühmtesten Unternehmen in der Geschichte des israelischen Geheimdiensts durchgeführt. Jetzt war er müde und angeschlagen nach Rom zurückgekehrt, wo alles begonnen hatte. Einer der wenigen Menschen, denen er vertrauen konnte, war ein katholischer Geistlicher namens Luigi Donati.
Gabriels Blick wanderte durch den rechteckigen Raum mit Fresken von Botticelli und Perugino zu dem dickbäuchigen kleinen Ofen hinüber, in dem bei Konklaven die Stimmzettel verbrannt wurden. Dann rezitierte er: „›Das Haus aber, das der König Salomo dem Herrn baute, war sechzig Ellen lang, zwanzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch.‹“
„Das erste Buch der Könige“, sagte Donati. „Kapitel sechs, Vers zwei.“
Gabriel sah an die Decke. „Ihre Vorväter haben dieser eher schlichten Kapelle nicht ohne Grund genau die Abmessungen von Salomos Tempel gegeben. Aber weshalb? Wollten sie damit die Juden als ihre älteren Brüder ehren? Oder damit verkünden, das alte Gesetz sei durch ein neues ersetzt und der alte Tempel mitsamt dem Allerheiligsten nach Rom versetzt worden?“
„Vielleicht war es etwas von beidem“, erwiderte Donati philosophisch.
„Wie diplomatisch von Ihnen, Monsignore.“
„Ich bin von Jesuiten ausgebildet worden. Vernebelung ist unsere Stärke.“
Gabriel sah auf seine Armbanduhr.
„Merkwürdig, dass die Kapelle um diese Zeit noch leer ist.“
„Ja“, sagte Donati geistesabwesend.
„Wo sind die Touristen, Luigi?“
„Im Augenblick sind nur die Museen fürs Publikum geöffnet.“
„Warum?“
„Wir haben ein Problem.“
„Wo?“
Donati neigte stirnrunzelnd den Kopf nach links. Das Treppenhaus, das vom Prunk der Sixtinischen Kapelle in die prächtigste Kirche der Christenheit führt, ist eine hässliche graugrüne Röhre mit glatten Betonwänden. Auf diesem Weg gelangten Gabriel und Donati unweit der Kapelle der Pietà in den Petersdom. In der Mitte des Kirchenschiffs bedeckte eine gelbe Plane etwas, das unverkennbar eine Leiche war. Vor ihr standen zwei Männer, die Gabriel bereits kannte. Der eine war Oberst Alois Metzler, Kommandant der Schweizergarde. Der andere war Lorenzo Vitale, Chef des Corpo della Gendarmeria, der hundertdreißig Mann starken Vatikanpolizei. In seinem früheren Leben hatte Vitale als Angehöriger der Guardia di Finanza gegen korrupte Beamten ermittelt. Metzler war ein pensionierter Schweizer Offizier. Sein Vorgänger Karl Brunner war bei einem Terroranschlag der al-Qaida auf den Vatikan ums Leben gekommen.
Die beiden Männer beobachteten Gabriel Allon, wie er das Kirchenschiff an der Seite des zweitmächtigsten Mannes der katholischen Kirche durchquerte. Metzler war sichtlich ungehalten, als er Gabriel mit der kalten Präzision eines Schweizer Chronometers die Hand gab und dabei nur knapp nickte. Er war groß und breitschultrig wie Donati, der Allmächtige hatte ihm jedoch das faltige Gesicht eines Bluthunds gegeben. Zu seinem dunkelgrauen Anzug trug er ein weißes Oberhemd und die silberne Krawatte eines Bankiers. Eine kleine randlose Brille vergrößerte seine blauen Augen, denen fast nichts entging. Der Oberst hatte Freunde in Schweizer Geheimdienstkreisen und wusste deshalb von Gabriels Unternehmen auf dem Boden seines Heimatlands.
Oberst Metzlers Anwesenheit im Petersdom war bemerkenswert. Streng genommen fielen Leichen im Vatikan in die Zuständigkeit der Gendarmen und nicht der Schweizergarde – außer sie tangierten die Sicherheit des Heiligen Vaters, versteht sich. War das der Fall, konnte Metzler seine Nase überall hineinstecken. Fast überall, dachte Gabriel, denn hinter den Mauern des Vatikans gab es Orte, die nicht einmal der Kommandant der Palastwache betreten durfte.
Donati wechselte einen Blick mit Vitale, dann wies er den Polizeichef an, die Plane zu entfernen. Die Tote musste aus großer Höhe gestürzt sein, denn vor ihnen lag ein zerschmetterter Körper mit zahllosen Knochenbrüchen und zerfetzten Organen. Erstaunlicherweise war das attraktive Gesicht weitgehend intakt. Auch der Dienstausweis, den sie umgehängt getragen hatte, war unbeschädigt geblieben. Gabriel machte sich nicht die Mühe, den Namen zu lesen. Die Tote war Claudia Andreatti, Kuratorin der Antikensammlung.
Mit dem Gleichmut eines Mannes, der schon viele Tote gesehen hat, ging Gabriel neben ihr in die Hocke und begutachtete sie wie ein restaurierungsbedürftiges Gemälde. Wie alle Laiinnen im Vatikan war sie dezent gekleidet: schwarze Hose, weiße Bluse, graue Wolljacke. Ihr heller Kaschmirmantel war aufgeknöpft und wie ein Cape um sie herum ausgebreitet. Der rechte Arm lag quer über dem Unterleib, der linke Arm hingegen war gerade ausgestreckt, das Handgelenk leicht abgewinkelt.
Die Augen der Toten waren geöffnet. Gabriel hatte sie zuletzt gesehen, als sie ihn auf einer Treppe im Museum begutachtet hatte. Begegnet waren sie sich am Vorabend kurz vor einundzwanzig Uhr. Gabriel war nach einem langen Tag vor dem Caravaggio-Gemälde auf dem Heimweg gewesen, während Claudia mit einem Stapel Akten in ihr Büro gewollt hatte. Sie war zwar in Eile gewesen, hatte aber keineswegs wie eine Frau gewirkt, die im Petersdom Selbstmord verüben wollte. Ganz im Gegenteil: Gabriel hatte ihren Blick als leicht flirtend empfunden.
„Sie haben sie gekannt?“, fragte Vitale.
„Nein, aber ich weiß, wer sie war“, entgegnete Gabriel.
„Mir ist aufgefallen, dass Sie beide gestern Abend noch sehr spät gearbeitet haben.“ Dem Italiener gelang es, diese Bemerkung beiläufig klingen zu lassen, obwohl sie es keineswegs war. „Laut der Kladde am Empfang haben Sie das Museum um 21.47 Uhr verlassen. Dottoressa Andreatti ist wenig später gegangen, um 21.56 Uhr.“
„Da hatte ich den Vatikan schon durchs Annentor verlassen.“
„Ich weiß.“ Vitale lächelte humorlos. „Die dortigen Listen habe ich auch kontrolliert.“
„Dann werde ich also nicht mehr verdächtigt, meine Kollegin umgebracht zu haben?“, konterte Gabriel sarkastisch.
„Entschuldigen Sie, Signor Allon, aber wenn Sie im Vatikan aufkreuzen, kann es leicht mal Tote geben.“
Obwohl Polizeichef Vitale Anfang sechzig war, sah er wie einer dieser sonnengebräunten italienischen Filmstars aus, die mit einer weit jüngeren Frau in einem offenen Cabrio auf der Via Veneto unterwegs sind. In der Guardia di Finanza hatte er als unbeugsamer Eiferer gegolten, der sich die Aufgabe gestellt hatte, die Korruption in Politik und Wirtschaft Italiens einzudämmen. Als ihm das nicht gelungen war, hatte er sich in den Vatikan zurückgezogen, um seinen Papst und seine Kirche zu beschützen.
„Wer hat sie aufgefunden?“, fragte Gabriel.
Vitale nickte zu einigen Sanpietrini hinüber, die sich in respektvoller Entfernung hielten.
„Haben sie irgendetwas verändert?“
„Wie kommen Sie darauf?“
„Sie ist barfuß.“
„Einen ihrer Schuhe haben wir in der Nähe des Baldachins gefunden. Der andere hat vor dem Altar des heiligen Josef gelegen. Wir vermuten, dass sie während des Sturzes abgefallen sind. Oder…“
„Oder was?“
„Sie könnte sie auch von der Galerie unter der Kuppel geworfen haben, bevor sie gesprungen ist.“
„Wozu?“
„Vielleicht wollte sie sehen, ob sie wirklich die Nerven hatte, es zu tun“, schlug Metzler vor. „Eine Anwandlung von Zweifel.“
Gabriel sah nach oben. Gleich oberhalb der lateinischen Inschrift am Fuß der Kuppel befand sich die Besucherplattform, an die sich eine umlaufende Galerie anschloss. Ihr Geländer war hoch genug, um Selbstmorde schwierig, aber nicht unmöglich zu machen. Tatsächlich mussten Vitales Gendarmen alle paar Monate jemanden daran hindern, sich in die Tiefe zu stürzen. Am späten Abend, wenn der Petersdom für Besucher geschlossen war, hätte Claudia Andreatti die Galerie allerdings für sich allein gehabt.
„Todeszeitpunkt?“, fragte Gabriel so ruhig, als stelle er diese Frage der Toten.
„Unklar“, antwortete Vitale. „Einmal wöchentlich schaltet die Sicherheitszentrale die Überwachungskameras für einen routinemäßigen Neustart aus. Das machen wir spätabends, wenn die Kirche für Besucher geschlossen ist. Im Allgemeinen ist das kein Problem.“
„Wie lange bleiben sie abgeschaltet?“
„Von neun bis Mitternacht.“
„Merkwürdiger Zufall. Wie hoch mag die Wahrscheinlichkeit sein, dass sie beschlossen hat, Selbstmord zu verüben, während die Kameras abgeschaltet waren?“
„Vielleicht war das kein Zufall“, sagte Metzler. „Vielleicht hat sie diesen Zeitpunkt absichtlich gewählt, damit ihr Tod nicht aufgezeichnet würde.“
„Woher hätte sie wissen sollen, dass die Kameras ausgeschaltet waren?“
„Das ist hier allgemein bekannt.“
Gabriel schüttelte langsam den Kopf. Trotz der Gefahren, die von Terroristen und anderen drohten, waren die Sicherheitsmaßnahmen im kleinsten Staat der Welt verblüffend lasch. Darüber hinaus genossen die im Vatikan Tätigen ungewöhnlich viel Bewegungsfreiheit. Sie wussten, welche Türen nie abgeschlossen waren, welche Kapellen nie benutzt wurden und in welchen Lagerräumen man völlig ungestört eine Verschwörung planen oder Sex haben konnte. Sie kannten auch alle in den Dom führenden Geheimgänge, von denen einige auch Gabriel bekannt waren.
„War außer ihr noch jemand in der Kirche?“
„Soweit wir wissen, nein“, antwortete Vitale.
„Aber Sie können es nicht ausschließen.“
„Richtig. Andererseits hat niemand etwas Ungewöhnliches gemeldet.“
„Wo ist die Umhängetasche der Toten?“
„Die hat sie vor dem Sprung auf der Galerie abgestellt.“
„Fehlt etwas daraus?“
„Unseres Wissens nicht.“
Trotzdem fehlte irgendetwas. Gabriel kam nur nicht gleich darauf. Er schloss die Augen und stellte sich Claudia Andreatti vor, wie er sie am Vorabend erlebt hatte – das warme Lächeln, der kokette Blick aus den braunen Augen, die an ihre Brust gedrückten Akten.
Und das Goldkreuz an einer dünnen Halskette.
„Ich möchte mich auf der Galerie umsehen“, erklärte Gabriel.
„Ich bringe Sie hinauf“, bot Vitale ihm an.
„Danke, nicht nötig. Der Monsignore ist bestimmt so freundlich, mich zu begleiten.“




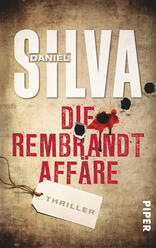










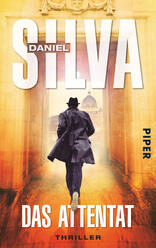



Das Buch möchte ich sehr gerne weiterempfehlen und vielleicht nicht so sehr den klassischen Lesern des Thrillers Genres, sondern eher jenen Lesern, die sich für den Konflikt im Nahen Osten interessieren oder auch sonst für politische Thriller. Denn dies spielt schon eine gewisse Rolle in dem Buch. Wer also einen spannenden, interessanten Thriller lesen möchte und es zudem liebt, auf falsche Fährten gelockt zu werden, demjenigen möchte ich das Buch gerne ans Herz legen. Der Kauf lohnt sich sehr, zumindest meiner Meinung nach. Dieses Fazit ist ursprünglich auf www.lovelybooks.de erschienen.
Gabriel Allon ist ein moderner Topspion - melancholisch, knallhart und trotzdem weich. Eine spannende Hetzjagd durch Europa und den Nahen Osten. Dieser Leseeindruck ist ursprünglich auf www.lovelybooks.de erschienen.
Sehr geehrte Damen und Herren, Ich kann mich den Texten meiner Vorschreiber nur anschließen. Bitte bringen Sie die Bücher von Daniel Silva auch als E- Book raus. Das hat doch mit dem Hintermann auch schon hervorragend angefangen. Bitte, bitte !!!! Ich liebe die Gabriel Allon Reihe und meinen Kindle.... Viele Grüße Marc Seddig
Ich kann Andreas nur zustimmen. Ich habe bisher alle Daniel Silva gelesen, seit einiger Zeit besitze ich nun einen e-book-reader. Unter anderem weil gerade diese Art Buch mein Reisegepäck um ein vielfaches sprengen. Leider ist es nun nicht möglich Silva-Bücher auf meinem kindle zu lesen, das ist sehr schade. Aber nach Südostasien nehme ich wohl die zwei jüngsten Bücher nicht mit - und werde sie daher leider auch nicht kaufen (können).
Liebes Piper Verlagsteam, als glühender Fan der Gabriel Allon Reihe, warte ich schon sehnsüchtig auf die neuen Geschichten. Da ich jedoch schon seit einigen Jahren mit ebook reader bewaffnet durchs Leben ziehe sind mir Hardcover Ausgaben einfach zu unhandlich, um Sie immer bei mir zu führen (U-Bahn, S-Bahn, etc...). Ein Krimi ist jetzt auch nicht die Art Literatur die ich mir im Wohnzimmeregal aufhebe. Einmal gelesen und dann weg damit. Wieso verweigert sich Piper, nachdem ja schon einige Bücher dieser Reihe als Ebooks verfügbar waren, konsequent gegen dieses Format. Bitte überdenkt im Sinne des Wandels der Zeit Eure Strategie. Man kann ja gerne beide Versionen koexistieren lassen. Ich verstehe schon, dass einige Leute gerne am Abend im Sofa lehnen und nach wie vor ein echtes Buch in Händen halten wollen - aber es gibt auch andere.
Eine Tote in der Vatikanstadt sorgt für Aufregung. Die Ermittlungen werden aus der Öffentlichkeit gehalten. Gabriel ist mitten in einer Restaurierung, als er in die Kapelle gerufen wird. Gabriel kannte die Tote flüchtig und es steht fest, dass es kein Selbstmord war. Gabriel ermittelt diesmal im Auftrag der Kurie. Atemraubend spannend, einfach ein Klassiker!!!
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.