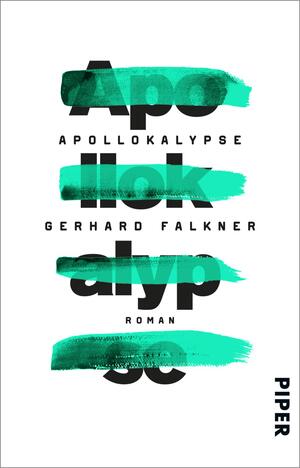

Apollokalypse
Roman
„Bewusst erratisch verlaufen die Handlungssprünge, und doch entwickelt dieser verquere Bildungsroman, der sich auch aufs Komische versteht, einen mitreißenden Sound, der nicht nur auf Tempo setzt, sondern mit einer Beobachtungsdichte glänzt, die auch für das heutige Berlin noch als herausragende Schule des literarischen Sehens dienen kann.“ - Der Tagesspiegel
Apollokalypse — Inhalt
Georg Autenrieth ist eine zwielichtige Gestalt. Immer wieder taucht er auf in Berlin, hält Kontakt mit der Szene, durchsucht die Stadt und zelebriert Laster, Lebensgier und Liebeskunst. Wohin aber verschwindet er dann? Wer ist der „Glasmann“? Und welche Rolle spielen seine Verbindungen zur RAF? Gerhard Falkners „Apollokalypse“ ist ein Epochenroman über die 80er und 90er Jahre. Dem Vergeuden von Jugend, der Ausschweifung und der Hypermobilität stellt er einen rauschhaften Rückverzauberungsversuch entgegen. Ein mythologischer Roman von unvergleichlicher Sprachmächtigkeit.
Leseprobe zu „Apollokalypse“
Nach der Schlacht
Es könnte Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre einen Mann gegeben haben, der auf der Oranienstraße, zwischen Moritzplatz und Mariannenstraße, einem Frühlingstag ins Auge geblickt hat, an den er sich später nicht mehr erinnert. Es mag ein schwach von der Braunkohle gesüßter Frühlingstag gewesen sein, April oder Anfang Mai, wie er für SO 36, wo es noch unzählige Wohnungen mit Kaminfeuerung gab, typisch war. Vielleicht kam die Süße der Braunkohle auch aus dem Osten, der jenseits der Mauer darauf wartete, vom Westen verheizt zu [...]
Nach der Schlacht
Es könnte Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre einen Mann gegeben haben, der auf der Oranienstraße, zwischen Moritzplatz und Mariannenstraße, einem Frühlingstag ins Auge geblickt hat, an den er sich später nicht mehr erinnert. Es mag ein schwach von der Braunkohle gesüßter Frühlingstag gewesen sein, April oder Anfang Mai, wie er für SO 36, wo es noch unzählige Wohnungen mit Kaminfeuerung gab, typisch war. Vielleicht kam die Süße der Braunkohle auch aus dem Osten, der jenseits der Mauer darauf wartete, vom Westen verheizt zu werden. Nirgends war der Osten so nah wie in Kreuzberg. Das Frühlingslicht schien den lebhaft aufglühenden Fassaden einmassiert wie Sonnenöl den Rücken badender Frauen am Wannsee. Die Naunynstraße stand noch ganz in ihrer unrenovierten Strenge und Riehmers Hofgarten zeigte gelassen die abgetakelten Züge würdiger Verwitterung. Darüber hinaus brachten entweder die Türken Farbe rein mit ihren Obstkisten-Barrikaden vor den Geschäften oder die Autonomen mit auf Bettlaken gesprühten und aus den Fenstern gehängten Kampfparolen oder Hausbesetzersprüchen.
Ich lebe nun schon, solange ich denken kann, und es ist auch eine Menge in meinem Gedächtnis haften geblieben, aber an diesen besagten Tag konnte ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Vielleicht, weil er den vielen anderen so ähnlich war, die sich, wenn man es denn genau nähme, alle nicht wirklich glichen. Aber in dieser Geschichte wird meinem Gedächtnis ja auf die Sprünge geholfen. Der Mann, von dem ich wahrheitsgemäß behauptet habe, nicht zu wissen, dass ich es selbst gewesen sein könnte, wird mit dem Orientexpress, wie die Linie 1 der Türken wegen genannt wurde, vom Nollendorfplatz gekommen und am Kottbusser Tor ausgestiegen sein. Durch das heillose Fiasko von Hunden, Punks, Türken, Trödlern, Freaks, Junkies und Müslis wird er hinübergegangen sein in die Oranienstraße, um dort, vielleicht in der O-Bar, in der ich in jenen Jahren tatsächlich verkehrte, einen Drink zu nehmen. Diese Bar war damals einer der ersten Orte im Land, der wirklich cool war. Und cool hieß: schwarz, stolz, stumm und grundlos selbstverliebt.
Kreuzberg kochte in diesen Tagen ein Süppchen, von dem sich heute weder der Kessel noch auch nur Spuren des Gebräus wiederfinden. Es war ein schwarzes Loch, über dem die bunteste aller möglichen Sonnen explodierte und in dem die Nacht sich durch die Straßen bewegte wie eine Künstlerin oder eine Kakerlake. Kreuzberg war Westberlins kritische Zustandsgröße, der Übergang von der festen in die, wie wir damals sagten, zweitfeste Wirklichkeit. Welche der allgemeinen geistigen Verfassung die zuträglichere war, darüber wurde gestritten. Warum jeder Dritte, den ich kannte – dies nur nebenbei bemerkt –, in der Wrangelstraße wohnte, so wie später, nach der Wende, jeder Dritte in der Dunckerstraße, ist mir schleierhaft.
Hätte er, oder ich in diesem Falle, sich erinnert, so, wie Henriette sich erinnert haben muss, würde er wissen, dass dieser Tag begann wie eine gewisse Erzählung Dostojewskis. Man erwartete zum Mittagessen wichtige Leute, auch wenn die Aufmachung dieser Leute von der gewöhnlichen Aufmachung wichtiger Leute, und erst recht von der Aufmachung wichtiger Leute heute, ziemlich abwich.
Das Treffen fand in der Wrangelstraße statt. Mit dem Rücken gegen das offene Fenster im vierten Stock gelehnt hätte ich, oder er, der nun ich gewesen sein soll, auf der gegenüberliegenden Hauswand die von einer Kalaschnikow durchbohrten Initialen RAF lesen können, während der Trupp wichtiger Leute, einschließlich Henriette, nachdem man schließlich vollzählig war, über einen durch einen Schrank verdeckten Mauerdurchbruch in die angrenzende Wohnung verschwand. Das Mittagessen wurde mit größter Wahrscheinlichkeit aus dem Papier eingenommen.
Trotz aller Stilbrüche hatte die Operation etwas Bestechendes. Vielleicht hatte ich das Ganze absichtlich vergessen, weil es mich gekränkt hatte, von diesen Desperados wie Luft behandelt zu werden. Man muss es mir angesehen haben, dass ich von einem anderen Stern kam.
Nach einer halben Ewigkeit war es dann endlich Nachmittag. Zwecklos, sich heute auf die genaue Uhrzeit besinnen zu wollen. Irgendwann um die Zeit, als er zu träumen begann, und zwar nicht wie die Mädchen, sondern wie die Tiere. Die Männer und Gudrun, neben Henriette die einzige Frau, waren durch das Wandloch zurückgekehrt, schoben den Schrank wieder davor, und weg waren sie. Ihre Stimmen hallten noch eine Weile durchs Treppenhaus. Dann erstarben sie, und nach dem Zufallen der Haustür schien die Straße plötzlich stummgeschaltet. Nach einer weiteren halben Ewigkeit trat Henriette mit einem schweren, blauen Handtuch umwickelt aus ihrem badewannenlosen Bad ohne Dusche.
Augenblicklich stellte ich mir vor, es sei Winter. Die milde Luft, die durch das Fenster hereinströmte, vermochte das nicht zu verhindern. Henriette wirkte auf mich mit dem polaren Weiß ihrer Haut wie die Abgeordnete einer eisigen Region, die mir die in blaue Baumwolle gewickelte Frühlingsbotschaft zu überbringen gedachte. Mein limbisches System nahm eine kleine körpereigene Dusche. Obwohl man damals immer in dem Gefühl lebte, mit allem rechnen zu müssen, erinnerte nichts in diesem Augenblick an die Möglichkeit, der Kommunismus könnte die Segel streichen oder das Leben könnte damit aufhören, einen verrückten Tag nach dem anderen zu spendieren.
Es war noch das Kreuzberg der auf dem Boden liegenden Matratzen, der gardinenlosen Fenster, selbstgebastelten Bücherregale und Chai Tees. Auch Momente des Glücks nahmen hier notfalls behelfsmäßig ihren Lauf. In eine dieser auf dem Boden liegenden Matratzen trieb nun, nachdem das blaue Handtuch kurzerhand zum offenen Fenster hinausgesegelt war, Henriette ihre schrillen, spitzen Seufzer wie Polsternägel, und die Kohlmeisen, die draußen monoton nach ihren Partnern bimmelten, stimmten ein. Wäre Henriette, die sich nie Rieke nennen lassen wollte und die auch nicht vorhatte, früh zu sterben, damals nicht mit jenem Mann zusammen gewesen, der vielleicht für beides verantwortlich war und der mit seinem runden, gedrungenen Kopf und seinem kleinen, wagemutigen Körper Alleinanspruch auf sie erhob, wäre ich, oder der, für den ich mich inzwischen wohl halten muss, wahrscheinlich gleich über Nacht bei ihr geblieben. So aber wurde jener kleine, wagemutige Körper, der nicht nur eine Strickmaske, sondern auch eine Waffe besaß und den besagte Abordnung um 18 Uhr in einer Kaschemme hinter dem Mariannenplatz treffen wollte, in Kürze erwartet, und ich hatte das Feld zu räumen.
Ich sollte ab Mitternacht in der Roten Harfe nach einem Lutzi fragen, der den Schlüssel zu einer Wohnung dabeihaben würde, in der ich übernachten konnte. Jene Nacht, jedenfalls knapp zwei Stunden davon, verbrachte ich, wie ich heute weiß, in der Eisenbahnstraße.
Ein ebenfalls kleiner Mann mit fanatischen Augen und einem Gipsfuß gab mir den Schlüssel, als ich kurz vor zwei in diesem überwiegend aus Zigarettenrauch bestehenden Laden eintraf. Teufel noch eins, dachte ich, hier mischen sich aber die Sphären. Alle Gesichter waren vom Qualm wie in Watte gepackt und viele Stühle und Stimmen waren umgeworfen vor lauter Lärm. Die Wohnung lag wie gewöhnlich im vierten Stock rechts. Egal, wo ich damals hinmusste, immer lagen die Wohnungen im vierten Stock rechts. Im Treppenhaus reichte der trübe Schimmer der Nacht, um das Schlüsselloch zu finden. In der Wohnung selbst aber gab es nicht einmal eine Ahnung von Licht. Sie musste durch Gummivorhänge oder dergleichen verdunkelt sein. Die Augen schienen wie zugenäht von der Schwärze. Egal, wie lange mein Arm mit wehenden Bewegungen die Wand abtastete, kein Schalter gab sein Versteck preis. Kein Laut, kein Licht, kein Drink, kein Blick, keine Unterlage – nichts.
Wie der blinde Seher, die Arme so vorgestreckt, dass die Finger auf Gott deuteten, durchwatete ich die Schwärze, bis mein Fuß gegen den federnden Widerstand einer Kreuzberger Bodenmatratze stieß, auf die ich hinabglitt. Die Art, wie diese Wohnung den Augen einfach keine Hoffnung versprach – und nicht einmal, wie noch die dunkelsten Kinos der Welt, nach einer Weile wenigstens Konturen preisgab –, ließ mich eine Weile steif und mit gerecktem Hals dasitzen, bis mir klar wurde, dass diese Finsternis durch keine lauernde Haltung je zu bezwingen war. Mein ganzer Körper wölbte sich wie ein Parabolspiegel, um entlang eines doch wohl ganz sicher irgendwo angehaltenen Atems endlich den Horizont eines heimlichen Luftschöpfens aufzufangen. Keine Chance. Dennoch schien es mir mit der Zeit, während ich dalag und kaum atmete, immer wahrscheinlicher, dass diese Wohnung in ihrer undurchdringlichen Finsternis mit einer weiblichen Person ausgerüstet war, einer Person, irgendwo zwischen Angst, Schlaf oder Betäubung. Entweder nur durch eine angelehnte Tür getrennt oder sogar direkt in diesem Raum, auf einer am anderen Ende liegenden Matratze. Eine Frau, die vielleicht nicht nackt dalag, nicht lustvoll geblendet von der Dunkelheit und begierig, von mir entdeckt zu werden, wie mir ein aberwitziger Gedanke weismachen wollte, je dichter sich mein Registrationsschirm mit Partikeln ihrer Existenz beschlug, sondern die in dieser Dunkelheit einfach untergebracht war. Versteckt. Vergraben. Eingemauert. Vielleicht auch gekocht oder zerstückelt. Was konnte ich schon wissen.
Das Spüren wurde so stark, dass meine Ohren dünn und hart wurden wie Glas, die das kleinste Hämmerchen eines Lauts hätte zerspringen lassen. Meine Finger spreizten sich im Gegenzug so nervös, als müssten sie totes Fleisch berühren, und sogar die Zähne, vom Schutz der Lippen durch die Anspannung teilweise entblößt und mit einem zweifelnden und zögernden Abstand zwischen ihren Reihen, schienen wie Spezialsonden dieses vermeintliche Gegenüber orten zu wollen. Lag hier vielleicht Henriette, gefesselt und betäubt von dem Kerl mit dem kleinen, wagemutigen Körper? Hatte nicht am Nachmittag eine jener wichtigen Personen bei der Rückkehr aus dem Wandloch gesagt: „Die Dinger liegen in der Eisenbahnstraße“? In dem Drange, irgendetwas zu unternehmen, was mir, wäre ich eingeschlafen, nicht im Traum eingefallen wäre, verließ ich die Wohnung wieder. Ich hatte so lange Schäfchen gezählt, bis ich Herzrasen bekam.
Der Tag war noch nicht angebrochen, als ich die Wrangelstraße erreichte und an der St.-Thomas-Kirche, die mich mit einem einzigen, ungeduldigen und frigiden Glockenschlag erschreckte, Richtung Spree abbog. Viertel nach vier.
Neben mir lief die Mauer. Neben der Mauer lief ich. Wir liefen quasi nebeneinanderher. Einer stummer als der andere. Sie schwieg aus politischem Trotz, ich aus innerer Anspannung. Der Sternenhimmel hatte sich um kaum zwei Stunden gedreht, seit ich das schwarze Loch verlassen hatte. Er hing schlapp über der Weite des Schienengeländes zwischen Warschauer Brücke und dem Hauptbahnhof der ehemaligen Reichsbahn. Über der Mauer stapelte sich wie Industrieschrott ein rostroter Nachthimmel, dahinter der gähnende Osten. Wie Perlenvorhänge wehten die zarten, pendelnden Triebe der Trauerweiden, als ich auf die Oberbaumbrücke zulief, die wie eine zerfallene Ritterburg aus dem Dunkel starrte. Die Turmhauben waren zerbrochen. Sie glichen den Zahnstümpfen zechender Bauern, wenn das Kerzenlicht der flämischen Meister sie beleuchtet. Vor der Brücke stand eine schwarze, hölzerne Tribüne, von der tagsüber ein Blick ins Reich des Bösen geworfen werden konnte. Oder auf seine ostdeutsche Vorhut. Sie stand da wie das hölzerne Gerüst vor Troja, welches die Griechen das Pferd nannten.
Ich widerstand der Anfechtung nicht, die eine leere Leiter in einsamer Nacht auf mich ausübt. Tribüne, Kanzel, Katheder – was für großartige Erfindungen. In der Mitte der Spree kreuzten Spanische Reiter ihre schwarzen Balken, und drüben auf der Eastside dröhnten die düsteren Speicher wie kolossale Bässe. Wo sich die Spree Richtung Osthafen breiter machte, erglänzten auf dem Wasser die ersten Perlmuttschimmer der Dämmerung. Mit einem würdigen „Salve!“ grüßte ich die tuckernden Blässhühner und die Möwen, die wohl ebenfalls den Tagesanbruch schon im Visier hatten.
Schließlich kehrte ich um und folgte dem eleganten Schwung der Mauer entlang des Bethaniendamms. Als ich unten am Moritzplatz ankam, spendierte die Sonne bereits ihre ersten Strahlen. Kreuzberg fing an zu krachen. Ladengitter, die Heckverschläge von Lieferwagen, knallende Türen, Paletten, platzende Geräusche, grausam kopfüber gegen das Heck von Müllautos geschmetterte Abfalltonnen, Türkenmusik.
In einem Dönerimbiss trinke ich türkischen Tee. Das Glas ist klein und heiß, mit einer schmalen Hüfte für die Finger. Um zehn Uhr wird der kleine Mann mit dem wagemutigen Körper aus dem Haus sein. Henriette hat mir das versichert. Es gäbe ein Treffen im Uni-Center mit Leuten aus Libyen, sagte sie. Oder Jordanien? Hat sie das gesagt oder hat sie gesagt, dass er das gesagt hätte? Wer immer es gesagt hat, es musste gesagt worden sein. Egal von wem und zu wem.
Eine zur Sicherheit eingehaltene halbe Stunde später würde sie mir ihre aufwühlende Zunge in den Mund stecken, nachdem sie endlich mit einem weiß-der-Teufel-wie-farbenen Handtuch um ihr weißes Winterfleisch aus ihrem badewannenlosen Bad ohne Dusche getreten sein würde. Sie würde ihn, quasi noch bettwarm, mit mir betrügen, ihren kleinen, strammen Stadtguerilla. Beide würden wir versuchen, in diesem süßen struggle for life, jeder aus dem anderen so viel herauszukitzeln, als er unter Schreien und Flüstern bereit war (ohne Gefährdung der Lust, aber nicht ganz ohne Gefahr für die eigene Person), sich entlocken zu lassen. Wer wusste damals schon so genau, für wen er eigentlich arbeitet?
Während ich Tee trinke und an sie denke, schwillt mein Schwanz.
Im Tagebuch des Verführers, in dem ich am Nachmittag des Vortags immer wieder gelesen hatte, um mir die Zeit in der Wrangelstraße zu vertreiben, lässt Kierkegaard seinen Helden sagen: „Meine Cordelia, Du weißt, ich frage gern viel; man macht mir geradezu einen Vorwurf daraus. Das kommt daher, dass man nicht versteht, wonach ich frage; denn Du und Du allein verstehst, wonach ich frage … und Du und Du allein verstehst, eine gute Antwort zu geben.“
Das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Wäre aber auch egal, wenn du das nicht verstehst, dachte ich etwas zynisch. Dann machte ich mich auf den Weg.
Ich wollte eine gute Antwort. Die eine, die es herauszufinden galt, die andere, die ich wahrscheinlich zu hören kriegen würde, und jene dritte, für die ich sie stöhnen sehen wollte.
„So wie du aussiehst, arbeitest du bestimmt für den BND“, hatte sie das letzte Mal gesagt.
„Wie sehe ich denn aus?“
Ich schaue hin. Ich sehe uns auf der Matratze knien, das Andocken zweier Köpfe, die auf den Schultern sitzen wie Blumentöpfe und blühen, mit großen Schlitzen dazwischen für das Lachen, und schließlich, von unten herauftönend, jenes schmatzende Geräusch, wie es sich mit zwei schnellen Fingern in einem Töpfchen mit von der Hitze geschmolzener Nivea-Creme erzeugen lässt.
Um halb elf ging ich zurück in die Wrangelstraße und klopfte bei Vogl. Es war niemand da. Es war nie wieder jemand da …
Wie sollte ich so viele Jahre später darauf eine gute Antwort geben können?
„Man liest Falkners Roman mit grossem Vergnügen, weil er nicht wie die einschlägigen Wenderomane mit wohlfeilen politischen Deutungen die Deformationen des Wiedervereinigungsprozesses blosslegen will. Vielmehr konzentriert er sich ganz auf die Obsessionen seines Helden, der die Energien der Metropole aufsaugt und eine Sprache findet für die sinnliche Grossstadterfahrung. Die poetisch leuchtenden, flackernden Bilder und grellen Orts- und Landschaftsbeschreibungen, mit denen Falkner die Metropolen Berlin und New York ausmisst und seinen Protagonisten immer wieder mit den Banalitäten des Alltags kollidieren lässt, zeugen von imponierender Sprachmächtigkeit.“
„Ein vorzüglicher Roman.“
„Kühn fasst der Lyriker Gerhard Falkner in seinem epischen Opus magnum die Genres des Berlinromans und des Teufelspakts in eins. Sein Roman wird zum Epochenbild und adelt die geteilte Stadt zum mythologischen Ort, ohne dabei die Komik zu vergessen, etwa die Verlagerung des leidigen Hundeproblems an den unterirdischen Fluss Styx.“
„Falkner hat ein opulentes Bühnenbild gezeichnet, mit eher glücklosen Figuren. Das ist viel mehr als ein Berlin-Roman. Berlin ist aber der beste aller Schauplätze, um die globalen Umbrüche der letzten Jahrzehnte unters Brennglas zu legen.“
„"Apollokalypse" ist ein kunstvoll gebauter Roman, der in seinen Beschreibungen der Leute, ihrer Redeweisen und ihrer Mentalität, aber auch in der Erzählweise und im Stil, in seiner Lust auf Verweise und Zitate selbst eine verschüttete Epoche wiederauferstehen lässt. [...]. "Apollokalypse" ist eine Hommage an eine untergegangene Welt, das Berlin der späten siebziger, der achtziger und neunziger Jahre.“
„In der Geschichte der Berlin-Literatur beginnt mit diesem Roman ein neues Kapitel.“
„Gerhard Falkner erweist sich auch in seinem Roman als ein Meister der Sprachschichtungen. Und der ungewöhnlichen Bilder. Wo der Himmel von "ganz kurz geschnittenem Blau" ist, ist die Literatur im emphatischen Sinn zu Hause.“
„Bewusst erratisch verlaufen die Handlungssprünge, und doch entwickelt dieser verquere Bildungsroman, der sich auch aufs Komische versteht, einen mitreißenden Sound, der nicht nur auf Tempo setzt, sondern mit einer Beobachtungsdichte glänzt, die auch für das heutige Berlin noch als herausragende Schule des literarischen Sehens dienen kann.“
„Die Welt, die im Schriftsteller Falkner steckt und aus der nach 30 vorbereitenden Jahren der wichtigste deutschsprachige Roman dieses Herbstes, wenn nicht der letzten Dekaden hervorging, die "Apollokalypse", ist eine Welt der Kontraste, der Abgründe und der funkelnden Sprachgewalt. Ein Diamant wurde uns geschenkt, erhaben und kantig, schön zugleich.“
„Man muss sich an diese Sprache in Falkners Opus magnum erst gewöhnen, die durchsetzt ist von funkelnden Bildern und herbeifantasierten Assoziationen, in der es lyrisch bebt und philosophisch überkocht.“
„Falkner beschreibt lustvoll, mit Freude an Sprache und Sprachwitz. Die Ebenen, die sein kunstvoll verschachtelter Roman auffächert, verbindet er mühelos zu einem von Leidenschaft, Querverweisen und Zitaten strotzenden Ganzen.“
„Gerhard Falkners Romandebüt im reifen Alter ist ein fantastisches Berlin-Porträt - vor allem der Vorwende-Zeit.“
„Gerhard Falkners lyrischer, grandioser, kaputter Roman ›Apollokalypse‹. (…) Noch nie, behauptet die Rezensentin einfach mal, ist ein manisches Krankheitsbild so dicht erzählt worden, als würde die Verzweiflung aus dem Buch direkt ins Herz springen.“
„Fazit: Deutsche Literatur kann manchmal auch großartig sein.“
„›Apollokalypse‹ ist ein opulenter, sprachmächtiger und kunstvoll rätselhafter Berlin-Roman des Lyrikers Gerhard Falkner.“
„Man liest Falkners Roman mit großem Vergnügen, weil er nicht mit wohlfeilen politischen Deutungen die Deformationen der deutschen Wiedervereinigung bloßlegen will, sondern sich ganz auf die Obsessionen seines Helden konzentriert, der die Energien der Metropole aufsaugt, und eine Sprache findet für die sinnliche Großstadterfahrung. Die poetisch leuchtenden flackernden Bilder und grellen Darstellungen, mit denen Falkner die Metropolen Berlin und New York ausmisst, zeugen von imponierender Sprachmächtigkeit.“
„Wer so viel Krawall um den Charakter seiner Erzählung macht, muss einige Sensationen zu bieten haben. Und tatsächlich hat der 65-jährige Schriftsteller Falkner den Lebensroman eines verwegenen Burschen aufgeschrieben. [...]. Es gibt viele genaue, anrührende Sätze in diesem Buch, das sich an zeithistorischen Details wie den stets auf dem WG-Boden lagernden Matratzen der Achtziger weidet, aber auch einiges pompöses Gedröhne. [...]. Das ist der Ameisenlauf der Welt, von dem Gerhard Falkners Roman kunstvoll und komisch erzählt.“




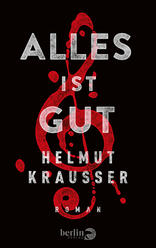
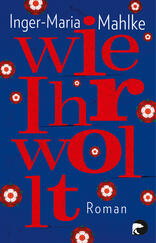










Gerhard Falkners „Apollokalypse“ ist ein exzessiver Roman, in dessen Zentrum eine nicht minder exzessive Stadt steht: Das Berlin der 80er und 90er Jahre. Den Ich-Erzähler Georg Autenrieth lässt die Stadt nicht aus ihrem Bann, denn trotz seiner Reisen um die ganze Welt, die mal im Nebensatz versteckt bleiben und mal über mehrere Kapitel ausgeführt werden, zieht es ihn immer wieder dorthin zurück. Dabei bleibt die Stadt aber auch der sicherste Bezugspunkt dieser Geschichte, denn Autenrieths Erzählungen sind selten linear und alles andere als zuverlässig. Zunehmend zweifelt er selbst am Erlebten: Er könnte Verbindungen zur RAF, zur Stasi, zum BND gehabt haben, er könnte sogar an einem Waffenschmuggel nach Westberlin beteiligt gewesen sein. Er kann es nicht genau sagen. Eine gewisse Sicherheit geben dem Leser die wiederkehrenden Personen, mit denen sich Autenrieth umgibt. So erzählt er von seinen Freunden aus Jugendtagen, die es mit ihm nach Berlin gezogen hat. Zum Beispiel Heinrich Büttner, der geniale, aber stark schizophrene Künstler, der in Berlin schließlich komplett überschnappt. Aber auch seine Liebschaften nehmen weite Teile der Erinnerung ein: Da sind Isabelle, die Kunststudentin und Femme fatale seines Freundeskreises oder Bilijana, die trinkfeste, nymphoman-veranlagte Bulgarin, die scheinbar enge Verbindungen zu Spitzen der Geheimdienste hat. Ich finde es großartig, wenn ich ein Buch nach dem Lesen nicht mehr aus dem Kopf bekomme. So war es bei „Apollokalypse“. Einen großen Teil der Faszination, die ich beim Lesen entwickelt habe, machten die Ungewissheiten in der Erzählung und die zunehmende Auflösung des Protagonisten aus. Als ich fertig war, hatte ich das Gefühl, ich könnte das Buch gleich ein zweites Mal lesen und unter ganz neuen Gesichtspunkten verstehen. Und wichtig – man muss keine besondere Beziehung zu Berlin haben, um das Buch großartig finden zu können. Ich selber kann meine Besuche in der Hauptstadt an einer Hand abzählen, aber Gerhard Falkner hat es mit seiner gewaltigen Sprache geschafft, aus Berlin einen mythischen Ort für mich zu machen.
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.